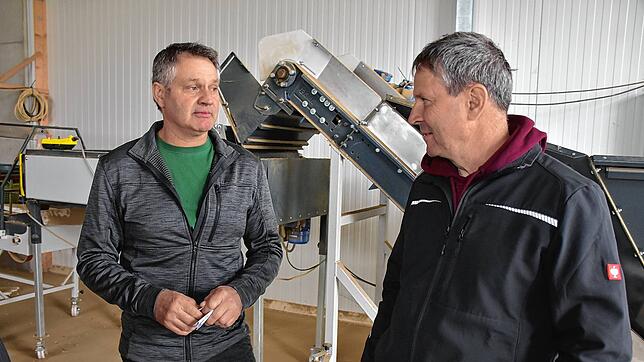Das Jahr 2024 stand in Hilzingen ganz im Zeichen des 500-jährigen Bauernkriegs. Und in diesem Jahr geht es mit diesem Thema spannend weiter: Anlässlich einer grenzüberschreitenden Veranstaltung des Interreg-Programms Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein fanden über 20 Vertreter aus Landwirtschaft und Politik auf dem Krützenbühlerhof in Duchtlingen zusammen, um sich in verschiedenen Stationen über die Herausforderungen in der Landwirtschaft auszutauschen.
Dabei wurde deutlich: Die Landwirtschaft steht in Deutschland und der Schweiz mit steigenden Kosten, mehr Regulierung und Bürokratie, Umweltauflagen und dem gesellschaftlichen Druck vor ähnlichen Herausforderungen. Der Krützenbühlerhof in Duchtlingen umfasst 133 Hektar Ackerland, 68 Hektar Grünland, 70 Milchkühe und jeweils 55 Mastochsen und Mastrinder. „In Nord- und Ostdeutschland ist ein Hof von dieser Größe ein Hobbybetrieb“, sagte Landwirt Volker Riede.
Im Nebenerwerb arbeitet er für den Maschinenring, macht die Grüngut-Abfuhr im Ort und seine Frau ist noch mit 50 Stellenprozent bei der Maggi in Singen beschäftigt. „Ohne unsere vier Aushilfskräfte, die auf Minijob-Basis angestellt sind, würde es nicht funktionieren“, machte Riede deutlich. Der jüngere seiner beiden Söhnen habe eine Ausbildung zum Landwirt begonnen.
Bauernkrieg gestern und heute
Die Landwirtschaft ist aber noch heute eng verknüpft mit der Vergangenheit. So tauchte an der zweiten Station auf dem Laurentiushof in Hilzingen Graf Wilderich von und zu Bodman in die Historie des Bauernkrieges im Hegau ein. Der 88-Jährige erzählte, dass die Gräfin Apollonia von Lupfen im Jahr 1524 von ihren leibeigenen Bauern während der Erntezeit auf ihrer Herrschaft Stühlingen verlangte, dass sie neben den schweren Arbeiten auch noch Schneckenhäuser sammeln sollten, die sie zum Garnaufwickeln benutzte.
„Das war für die Bauern der absolute Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte“, sagte Graf Wilderich und zog einen Vergleich zum vergangenen Jahr, als die Bauern nach der Streichung der Agrardieselvergütung zum Protestieren auf die Straße gingen. „Wir müssen den Holzprügel selbst in die Hand nehmen“, sagte der Gemüsebauer und Schweizer Nationalrat Manuel Strupler bei der anschließenden Podiumsdiskussion. An der nahmen auch der Hilzinger Bürgermeister Holger Mayer und die Agraringenieurin Kerstin Mock, Vizepräsidentin des Landfrauenverbandes Südbaden, teil.

Fehlen Bauern in der deutschen Politik?
Strupler sagte, dass es in Deutschland mehr Proteste brauche, damit die Politik die Nöte der Bauern versteht. Die Schweiz habe den Vorteil, dass die Landwirtschaft mit zahlreichen Vertretern mit landwirtschaftlichem Hintergrund im Parlament viel näher an der Basis sei. „Die deutschen Bauern sind in der Politik nicht vorhanden“, behauptete der Nationalrat.
Bürgermeister Holger Mayer hielt allerdings dagegen und bemerkte, dass in Hilzingen sieben der 24 Gemeinderäte einen landwirtschaftlichen Hintergrund haben, was es sonst in keinem anderen Gemeinderat im Hegau gebe.
Kerstin Mock ist in Markdorf ebenfalls Gemeinderätin. Sie erzählte, dass sie ihre Ratskollegen auf den Boden der Tatsachen zurückholen musste, als es um die Flächenphotovoltaik auf Gemeindegebiet ging. Es wäre zum Kollaps gekommen, wenn dadurch zusätzliche Flächen für die Landwirtschaft weggefallen wären, so Mock.
Die deutschen Landwirte beklagen insbesondere, dass die Schweizer Bauern in Deutschland viel höhere Pacht- und Kaufpreise bezahlen und in Deutschland verhältnismäßig günstig Nahrungsmittel produzieren würden, die sie in der Schweiz teuer verkaufen können. In Baden-Württemberg würden entlang der deutsch-schweizerischen Landesgrenze mittlerweile über 5700 Hektaren landwirtschaftliche Nutzfläche von Schweizer Bauern bewirtschaftet.
Das deutsch-schweizerische Abkommen aus dem Jahr 1958 macht es möglich, dass die Landwirte beider Länder in einem zehn Kilometer breiten Grenzstreifen landwirtschaftliche Produkte zollfrei ein- und ausführen dürfen.
Es ist ein Geben und Nehmen
Im Branchenverzeichnis von Hilzingen gibt es 22 landwirtschaftliche Betriebe, von denen vier in der Schweiz ansässig sind. Christian Müller, der in Thayngen einen Landwirtschaftsbetrieb führt, ist frisch als neuer Schaffhauser Bauernverbandspräsident gewählt worden. Er berichtete, dass sein Großvater schon vor dem Ersten Weltkrieg in der deutschen Nachbargemeinde Flächen bewirtschaftete und es eine Zeit gab, in der deutsche Landwirte gegenüber den Schweizer Bauern geschützt waren.
„Es war aber nicht die Schweiz, die diese Möglichkeit abgeschafft hat, es waren eure eigenen Politiker“, betonte Müller und bemerkte, dass im Gewerbe gerade umgekehrt der Fall ist. Damit sprach er den Einkaufstourismus an, der seit dem günstigen Euro-Wechselkurs im deutschen Grenzgebiet boome. „Man urteilt schnell, aber oft kennt man die Hintergründe nicht“, sagte Kerstin Mock.
Warum junge Landwirte für den Beruf brennen
Das Schlusswort der Diskussion kam vom Hilzinger Bürgermeister: „Es ist ein Geben und Nehmen.“ Zum Abschluss der Veranstaltung gab es auf der Vetterlifarm in Rheinklingen (TG) eine Podiumsdiskussion, bei der jeweils zwei junge Bauern und Bäuerinnen erklärten, welche Motivation sie für die Landwirtschaft haben.
Die 22-jährige Jasmin Schwer aus Rohrbach im Schwarzwald mag besonders die Stimmung unter den Jungbauern: „Jeder brennt für seinen Beruf und es ist anders als in der Industrie, wo man am Morgen an- und am Abend abstempelt und einem egal ist, was man dazwischen macht“.