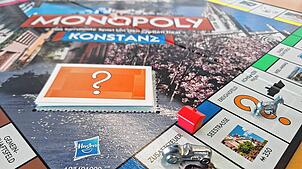Sigrid Gies erinnert sich noch gut an März 2020: Plötzlich waren die Kitas und Schulen geschlossen, das Land versank im ersten pandemiebedingten Lockdown. Die 35-jährige Juristin stand wie viele andere Konstanzer Familien vor einem Problem: Wohin mit den Kindern, wenn die Eltern arbeiten müssen? „Dann wurde mein Mann in Kurzarbeit geschickt, das war unser Glück“, sagt Gies rückblickend.
So konnte er den vierjährigen Joshua und die eineinhalbjährige Sarah sowie das Kind eines Kollegen betreuen. „Ich steckte zu jener Zeit mitten im Zweiten Juristischen Staatsexamen“, sagt Sigrid Gies. Doch Arbeitszeit musste sie sich trotzdem erkämpfen: „Da die durchgehende Kinderbetreuung für meinen Mann ungewohnt war, wurde ich anfangs viel mit reingezogen“, sagt die 35-Jährige. „Wir haben während dieser Zeit beide viel gelernt, aber sie war auch belastend, weil niemand wusste, wie es weitergeht.“
Uni-Professorin forscht zum Familienleben in Konstanz
So ähnlich ging es gefühlt vielen Familien. Doch vor etwa einem Jahr wollten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses im Gemeinderat und das Sozial- und Jugendamt es genauer wissen. Sie hofften auf einen detaillierteren Einblick in Konstanzer Familien während der Lockdowns, denn sie befürchteten, künftig verstärkt mit den Auswirkungen der Pandemie konfrontiert zu werden.
So wandte sich die Verwaltung an die Bildungsforscherin Axinja Hachfeld von der Uni Konstanz. Diese startete mit ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiterin Sonja Lorusso das Forschungsprojekt „FalKo“ („Familienleben in Konstanz“), dessen Ergebnisse nun vorliegen.

Über die Konstanzer Kitas nahmen die beiden Kontakt zu Familien mit Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren auf. „Im Mittelpunkt standen zwei Fragen: Erstens, wie Familien diese Zeit erlebt haben, und zweitens, ob sich Aussagen dazu treffen lassen, mit welchen Voraussetzungen die Kinder in die Schule kommen, die in den vergangenen zwei Jahren viel Vorbereitungszeit in den Kitas verpasst haben“, erläutert Axinja Hachfeld.
Zur Schulvorbereitung gehören feinmotorische Übungen, erstes Erkennen von Buchstaben, Puzzeln, Zählen. „Das alles findet natürlich auch zu Hause statt, aber unterschiedlich stark“, sagt die Professorin. Ihre Studie zeigte so auch: Familien, die die Förderung schulischer Fähigkeiten als die eigene Aufgabe sehen, machten sich weniger Sorgen um die Entwicklung ihres Nachwuchses als Eltern, die eher die Kitas in der Pflicht sehen.
Wie also können Kinder, die während der Schließzeiten weniger gefördert wurden, trotzdem einen guten Start ihrer Schulzeit erleben? Hachfeld meint: „Für sie müsste es zusätzliche Personal- und Zeitstunden geben, denn schon vor der Pandemie gab es viele Kinder, die beim Lese- und Schreiberwerb mehr Unterstützung brauchten. Dieser Anteil wird eher größer geworden sein.“
Familie berichtet von Fingernägelkauen und Einnässen
Was das Wohlbefinden während der Lockdowns angeht, offenbaren die Studienergebnisse ein gemischtes Bild vom Zustand der Konstanzer Familien. Über die Hälfte der Befragten (53 Prozent) gaben an, während der Kitaschließungen regelmäßig die Geduld mit dem Nachwuchs verloren zu haben. Auch an ihren Kindern bemerkten einige Eltern Veränderungen.
Eine Familie berichtete beispielsweise von „Fingernägelkauen und Einnässen tagsüber“, andere von „Lustlosigkeit und kein Interesse mehr an sozialen Kontakten“. Ein anderes Kind fing im ersten Lockdown an zu stottern, es wird von Rückschritten in der Sozialkompetenz gesprochen und von weniger Bereitschaft, auf Neues zuzugehen.
Appetitlosigkeit, Kopfschmerzen und mangelnde Bewegung
Allerdings vermerkten manche Eltern auch positive Auswirkungen der Lockdowns. So berichtet eine Familie, dass der Geschwisterstreit weniger geworden sei, eine andere sah deutliche Fortschritte beim kleinen Bruder, weil er alles mitbekam, was die große Schwester im Homeschooling lernte. Und immerhin nahm auch bei einem Drittel der in der Studie befragten Eltern die Freude zu, Zeit mit dem Kind zu verbringen.
Laut der Studie kamen zwar zwei Drittel der Kinder gut durch die Pandemie, doch ein Drittel der Eltern berichtet von nervösen und klammernden Kindern, etwas weniger auch von Kopf- und Bauchschmerzen sowie Ängsten. Auch das Familienleben hat in einigen Fällen gelitten: So gibt ein knappes Drittel der Befragten an, die Sorge um die finanzielle Situation habe sich durch die Pandemie deutlich vergrößert.
Streit in der Familie und der Eindruck, einsam zu sein, waren ebenfalls bei je etwa einem Drittel ausgeprägter als vor den Lockdowns. Ein Drittel der Eltern äußerten außerdem, ihre Kinder hätten öfter vor dem Bildschirm gesessen und weniger soziale Anregung genossen, als wenn die Kitas geöffnet waren. Knapp 60 Prozent gaben an, die Belastung durch mehr Hausarbeit habe (stark) zugenommen. Etwa die Hälfte spürte zudem mehr Stress durch die Arbeit.
Sogar 63 Prozent hatten das Gefühl, durch die Doppelbelastung mit Job und Familie die Bedürfnisse der Kinder nicht mehr zu erfüllen. Interessant dabei: Eltern mit Studium empfanden den Stress als deutlich größer als Eltern ohne akademischen Abschluss und fühlten sich auch erschöpfter. Professorin Hachfeld hat eine mögliche Erklärung dafür: „Diese Eltern konnten aufgrund ihrer Berufe häufig im Homeoffice arbeiten, mussten deswegen aber auch die Kinder parallel betreuen.“
Über die wichtige Rolle der Kitas im sozialen Gefüge
Dennoch brachte die Uni-Studie auch Erfreuliches ans Licht: Eltern, die sich über die Entwicklung ihrer Kinder sorgten, wandten sich ratsuchend zu 75 Prozent zunächst an ihre Kitas. „Diese sind ein wichtiger Informations- und Kommunikationskanal für Unterstützungsangebote“, so Hachfeld und Lorusso – sei es in Bezug auf Schulvorbereitung, Infos zu gesunder Ernährung oder Umgang mit digitalen Medien.
Rüdiger Singer, Jugendhilfeplaner im Sozial- und Jugendamt (SJA), fühlt sich durch die Ergebnisse bestätigt: „Deutlich wurde, dass Kitas auch oder gerade in Zeiten der Pandemie eine große gesellschaftliche Bedeutung zukommt. Für uns heißt das: Wir müssen Kitas stark machen, so dass sie diesem Auftrag nachkommen können.“
Die Stadt fühle sich einerseits in ihrem Handeln bestärkt, da sie gemeinsam mit den freien Trägern schon immer Wert auf Qualität gelegt habe, unter anderem durch großzügige Berechnungen von Personalschlüsseln. Andererseits sei die Stadt auch mit neuen Unterstützungsprogrammen auf einem guten Weg. So werden zum Beispiel einige Konstanzer Kitas zu Familienzentren mit zusätzlichem pädagogischen Personal entwickelt.
Rüdiger Singer ist sich aber auch bewusst: „Die Pandemie hinterlässt deutliche Spuren. Hier müssen wir achtsam sein und mit allen der Jugendhilfe zur Verfügung stehenden Mitteln Familien unterstützen. Angefangen von den Frühen Hilfen bis zu den Hilfen zur Erziehung haben wir einiges in der Hand.“ Insgesamt möchte Singer positiv in die Zukunft blicken: „Wir sollten versuchen, Sorge zu tragen, ohne zu besorgt zu sein, denn daraus kann schnell Angst entstehen – und Angst ist selten ein guter Ratgeber.“