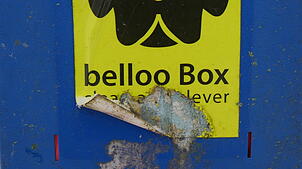Schon im dritten Jahrhundert sind Einsiedler belegt. Diese auch Eremiten genannten Männer verstanden sich als radikale Nachfolger Christi und suchten gleichsam aus Protest gegen die in ihren Augen Verweltlichung der Kirche Zuflucht in der Einsamkeit der Wüsten Ägyptens, Palästinas und Syriens. Das Eremitenleben war asketisch in Armut und Bescheidenheit. Sie verbrachte ihre Zeit mit Beten, Meditieren und Büßen. In Pfullendorf gab es zwar keine Wüste, aber bei der Wallfahrtskirche Maria Schray, früher weit vor den Toren der Stadt, lebten Eremiten.
Um die Wallfahrtskirche gibt es viele Legenden
Schon um das Jahr 1360 wird von der Kirche berichtet. Die Entstehung könnte sogar ins 13. Jahrhundert zurückführen. Im Juli 1632 rückten die Schweden von Mengen her gegen die Stadt und brannten die Wallfahrtskirche nieder. Der Legende nach soll das Gnadenbild unversehrt von Rauch und Flammen umgeben über Maria Schray geschwebt haben. Nach einer anderen Überlieferung schwebte das Gnadenbild in den nahen Neidlingwald und ließ sich dort auf einer Eiche nieder.

Muttergotteseiche steht bis heute im Neidlingwald
Diese „Muttergotteseiche“ kann noch heute besucht werden. Bald nach dem Dreißigjährigen Krieg im Jahr 1655 wurde mit dem Wiederaufbau der Wallfahrtskirche begonnen. Die sah ursprünglich außen ganz anders aus. Am heutigen Haupteingang befanden sich ein Schutzdach und ein Vorbau mit Treppe, über die man auf die Empore gelangen konnte. Bei großen Wallfahrten konnten die Gläubigen hier bei Sturm und Regen Schutz finden. Das Schutzdach wurde am 1. August 1895 abgebrochen. Direkt über der Sakristei der Wallfahrtskirche befand sich eine Wohnung, die von Mesnern und Eremiten bewohnt wurde. Heute dient diese Wohnung nur noch als Lagerraum für die Wallfahrtskirche.
Stadt fordert einen frommen Lebenswandel
Und das monumentale Kaplaneihaus nebenan, wo zuletzt ehemalige Stadtpfarrer und Ehrenbürger Elmar Hettler fast bis zu seinem Tod im September 2017 lebte, stammt aus dem Jahr 1863. Fließend Wasser gab es erst 1873. Bis dahin musste man das Wasser aus der Stadt holen, weil auch kein Brunnen vorhanden war. Vorher stand an der gleichen Stelle ein kleines, zweistöckiges Häuschen, das man für den Eremiten gebaut hatte, der sich um die Kirche kümmerte.

Eremiten wohnten außerhalb der Stadtmaueren von Pfullendorf
Letzter Bewohner war Sebastian Schober, der 1738 im Alter von 96 Jahren starb. Der Eremit war in Personalunion auch Mesner. Da der städtische Magistrat das Patronatsrecht für Maria Schray besaß, war er auch dafür verantwortlich, dass der Eremit Holz für den Ofen und natürlich auch zu essen hatte. Am 25. August 1731 verpflichteten Bürgermeister und Rat den Eremiten Benedikt Fischer als Mesnergehilfen als Unterstützung für den alternden Schober. Fischer musste eine Kaution von 800 Gulden stellen, die nach seinem Tod der Kirche Maria Schray zufallen sollte. Die Bewahrung der Paramente und des Opfergeldes bis zur Ablieferung sowie einen frommen Lebenswandel schrieb man ihm ganz besonders vor.
Lerchenfangen und Betteln für Eremiten verboten
Ab dem Jahr 1745 durfte in der Kirche das Allerheiligste aufbewahrt werden. Und ab 1748 nahmen die Wallfahrten enorm zu. Es musste also ständig eine Aufsicht vor Ort sein. Die Stadtoberen wollten aber nicht jeden. So wurde im Jahr 1746 der Bewerber Thomas Zudrell, ein ehemaliger Soldat, vom Rathaus abgelehnt. Er hatte sich von der Stadt entfernt, ohne sich beim Amtsbürgermeister abzumelden. Grundsätzlich waren den Stadtoberen das Lerchenfangen und das Betteln ein Dorn im Auge. Denn dann war niemand in der Kirche und in der Wohnung. 1718 beschlagnahmet die Stadt sogar das „Lerchengarn“ im Häuschen von Frater Sebastian. Dabei handelte es sich um Fangnetze für Singvögel.
Maria Schray war die Heimat der Eremiten
In alten Chroniken ist auch von zwei weiteren Eremiten die Rede. So Frater Josef, der bürgerlich Anton Winkler hieß und 18. Juni 1720 in Pfullendorf zur Welt kam. Er war seit 1750 Eremit in Maria Schray und starb 1782. Sein direkter Nachfolger war der im Jahr 1745 geborene Frater Felix Hopfer aus Kreenheinstetten. Im Jahr 1748 hatte die Stadt Ärger mit dem Bischof in Konstanz, weil sie die Eremiten angeblich schikanierte. Man konnte aber beweisen, dass diese ein ausreichendes Einkommen hatten. Sie gingen trotzdem auf Kollektur, wie das Spendensammeln damals hieß. Und damit die Gläubigen großzügiger waren, taten sie das im Dienstrock, was natürlich mehr Eindruck machte. Dass so etwas nicht geht, sah dann auch der Bischof ein. So mancher Eremit musste wieder gehen, weil er den eigenen Geldbeutel gefüllt hatte.