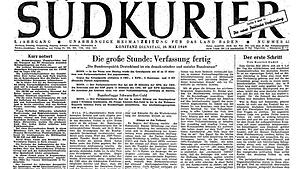Vor 50 Jahren landeten mit Neil Armstrong und Edwin „Buzz“ Aldrin erstmals Menschen auf dem Mond. Aufbruchstimmung und Experimentierfreude beeinflussten auch das Design der Zeit. Ob Mode, Möbel oder technische Geräte – überall hielten runde Formen, grelle Farben und neue Kunststoffe Einzug.
Der Wettlauf um die Eroberung des Weltalls zwischen der Sowjetunion und Amerika prägte im Kalten Krieg das Bewusstsein der Menschen in Ost und West. Die Übertragung der Mondlandung am 20. Juli 1969 verfolgten live im Fernsehen weltweit rund 600 Millionen Zuschauer. Eine ungebrochene Begeisterung für die Raumfahrt gepaart mit optimistischer Fortschritts-Euphorie erreichte ihren Höhepunkt.
Das „Space Age“ hatte 1957 mit dem Start des ersten „Sputnik“-Satelliten begonnen und setzte sich bis zum Ende des „Apollo“-Programms 1972 fort. Nachwirkungen in Mode und Technik waren bis in die späten 70er zu spüren. Damals schien die Zukunft im All und auch in greifbarer Nähe zu liegen.
Bereits 1929 hatte Regisseur Fritz Lang mit seinem Stummfilmklassiker „Frau im Mond“ das Interesse an der Raumfahrt und speziell an unserem Erdtrabanten geweckt. Zu jener Zeit war der Film aber reine Utopie, eine praktische Umsetzung scheiterte noch an den realen Möglichkeiten.
Wettkampf um den Weltraum
Das änderte sich mit den Raketenversuchen in Peenemünde während des Zweiten Weltkriegs, Wernher von Braun und die meisten seiner Wissenschaftler schlugen sich auf die Seite der Amerikaner und begannen mit den Sowjets einen Weltraum-Wettkampf, der erst mit der Mondlandung enden sollte.
Die Swinging Sixties waren nicht nur das Jahrzehnt von Twiggy, den Beatles und der ersten Mondlandung, sondern nun lautete das Motto statt „Keine Experimente!“ auch „Alles ist möglich!“. Filme wie „Barbarella“ mit Jane Fonda und Stanley Kubricks „2001 – Odyssee im Weltraum“ zeigten fantastische Sphären in Weiß und Silber mit sanft abgerundeten Kunststoffmöbeln.
Scence-Fiction-Sessel aus Finnland
In Kubricks Film hatten „Djinn“-Sessel des französischen Designers Olivier Mourgue für Airborn aus dem Jahr 1965 ihren ersten filmischen Auftritt – in der Eingangshalle der Raumstation.
1966 stellte der finnische Möbeldesigner Eero Aarnio seinen berühmten „Ball Chair“ vor, der damals zum Inventar vieler Science-Fiction-Filme gehörte. Seine Besitzer konnten sich wie in eine Höhle in die Kugel zurückziehen. Das Modell „Donna“ von Gaetano Pesce war aus Schaumstoff und so weich, dass sich sein Besitzer nur mit höchsten Anstrengungen aus ihm befreien konnte.
In der technologischen Entwicklung setzte die Raumsonde „Sputnik“ einen Meilenstein. Die gleichnamige Space-Age-Leuchte wurde zur Design-Ikone, es entstanden zahlreiche vielarmige Leuchtenformen. Der dänische Gestalter Verner Panton brachte 1969 seine „Flowerpot“ auf den Markt, die Snoopy-Lampe der Castiglioni-Brüder für Flos war im gleichen Jahr ihrer Zeit weit voraus.
Ob elektrische Mixer von General Electric mit original passendem Netzkabel, Wecker, Wand- und Tischuhren oder eine simple Wetterstation, im knallig-runden Space-Age-Design ließ sich alles vermarkten. Auch kugelförmige Radio- und Fernsehapparate wie das TV-Gerät „Discoverer“ von Philips oder runde Transistorradios aus Japan.
Vor allem italienische Designer wie Anna Castelli Ferrieri, Ettore Sottsass und Joe Colombo zeigten in den 1960er-Jahren futuristische Entwürfe. Zu den Favoriten gehörten bunte Alltagsgegenstände aus spritzgegossenem Kunststoff, die dominante Farbe war Orange.
Auch die Lavalampe erlebte damals einen Boom. Das im Glas gefangene Panorama der Leuchte suggerierte die Landschaften fremder Planeten. In der Innenarchitektur gab es Bestrebungen, von den gewöhnlichen vier Wänden abzuweichen. Der Weltraum mit seinen unendlichen Weiten zeigte sich beispielsweise im Aussichtsturm „Space Needle“ in Seattle in den USA.
Designer zeichneten Autos, die wie Raumschiffe aussahen. Straßenkreuzer trugen fette Raketenflossen und Endrohre im Chromdesign. Die Corvette von General Motors war zum inoffiziellen Dienstwagen zahlreicher Astronauten aufgestiegen. „Dass so viele von ihnen Corvettes fuhren, half sehr, das Image des Autos als Amerikas Sportwagen schlechthin aufzubauen“, glaubt Historiker Jerry Burton.
Auch der erste US-Amerikaner im All, Alan Shepard, wurde mit einer blank polierten weißen 1962er-Corvette belohnt. Weitere Space-Age-Cars waren der Sedan, Cyclone und Eldorado von Cadillac sowie der Plymouth Fury. In Europa setzte der 1000 SP von Auto Union auf das Space-Design, und auch Mercedes hatte ein Heckflossen-Modell im Angebot.
1961 eröffnete Modeschöpfer André Courrèges in Paris einen eigenen Salon. Schon drei Jahre später brach er mit alten Konventionen und stellte eine Kollektion namens „Space Age“ vor. Für die Kreationen nutzte er geometrische Formen und Materialien wie Vinyl, Papier und Plastik. Sein „galaktisches Mädchen auf dem Mond“ – das wohl erste Supermodel Jean Shrimpton – trug eine Art Raumanzug inklusive rundem Plexiglashelm.
Courrèges hasste BHs, Korsetts und High Heels, da sie nach seiner Meinung die Bewegungsfreiheit einschränkten. So beeinflusste er unter anderem auch Yves Saint Laurent, der später zugab: „Ich versank immer tiefer in traditioneller Eleganz und Courrèges zog mich aus diesem Abgrund heraus.“
Courrèges empfand sein Atelier wie ein Laboratorium, sein großes Vorbild war der schweizerisch-französische Architekt und Designer Le Corbusier.
Das Space Age hatte auch Musik
„Fly Me To The Moon …“ – das 1964 von Frank Sinatra aufgenommene Stück wurde im Juli 1969 den Astronauten von „Apollo 11“ während ihrer Landung vorgespielt. Schon in den 1950er-Jahren entwickelte sich das populäre Genre Space Age Music, 1962 erreichte der Instrumentalsong „Telstar“ von The Tornados Platz eins der US-Hitparade. Im Sommer 1969 gelang David Bowie mit „Space Oddity“ ein Welthit.
„In der Küche befindet sich alles in einer Armlänge griffbereit“, lautete schon vor 50 Jahren der innovative Ansatz von Luigi Colani bei seiner Mini-Küche namens Kitchen Satellite. Die von der ARD produzierte Serie „Raumpatrouille“ avancierte 1966 zum Straßenfeger, mit dem „Raumschiff Enterprise“ hielten bald auch Captain Kirk und Co. Einzug in die deutsche Alltagswelt.