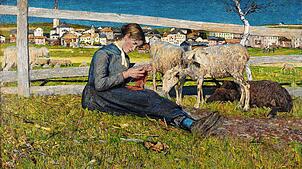Es hätte in Konstanz, in Wanne-Eickel oder in Greifswald passieren können. Es ist in München passiert: Sommer 2023, ein Fußballturnier ganz in der Nähe des Schlosses Nymphenburg. Acht- und neunjährige Kinder kämpfen darum, ein Turnier zu gewinnen, das niemand gewinnen wird. Denn nach dem Halbfinale prügeln Eltern der Vereine Eintracht Karlsfeld und Freie Turnerschaft Gern aufeinander ein. Der Organisator bricht das Turnier ab, kein Sieger.
Bei der Schlägerei fliegen Fäuste und es gibt Watschen – bayerisch für Ohrfeige. Sie verletzen zwei Väter und der Schiedsrichter bekommt auch eins ab, blutige Lippe. Eltern – und sogar ein Opa – lassen innerhalb von zwanzig Sekunden Frust ab, der sich ein zehnminütiges Spiel lang angestaut hatte. Als die Polizei am Sportplatz vorfährt, ist alles längst vorbei.
Die Trainer der beiden Mannschaften blieben unverletzt, einer wich einem Luftschlag aus. Der andere dachte ans Aufhören: „Jetzt reicht‘s, ich schmeiße hin“, sagte Thomas Schmidt von der FT Gern. Er schmiss nicht hin und Christoph Ischimbet, Eintracht Karlsfeld, sagt: „Wenn das Spiel eng ist, gibt es meistens Anfeindungen unter den Eltern.“ Besonders wenn sie nah am Spielfeldrand stünden. Er meint damit auch ausdrücklich Mütter, die „verbal hitziger“ mitfieberten als Väter. Letztens wurde bei einem Spiel – extra für die Eltern – eine zweite Seitenlinie gezogen. Fand Christoph Ischimbet gut.
Sind Eltern wirklich so schlimm? Manche Meldungen legen das nahe: „Spielabbruch in der C-Jugend: Fußball-Vater ohrfeigt Schiri (15)“, „Vater prügelt auf 16-jährigen Spieler ein“, „Vater (54) attackiert Schiedsrichter“, „Vater stürmte vor lauter Ärger auf den Platz und schlug zu“, „Vater schlägt Gegenspieler seines Sohnes“.
Manchmal zeigen Eltern größeren Ehrgeiz als ihre Kinder. Sie wissen genau, was die in diesem oder jenem Alter können sollten und übernehmen die Trainerposition. Sie provozieren deshalb Streit mit dem Kind – und dem richtigen Trainer. Auf der anderen Seite motivieren Eltern ihre Kinder, überhaupt Sport zu treiben, besser zu werden, fahren nach einem langen Arbeitstag zum Auswärtsspiel, feuern an, waschen Trikots, backen Kuchen.
„Zieh dir mal den Nagel aus dem Kopf!“
„Ohne sie läuft gar nichts“, hat mal ein Tennis-Bundestrainer gesagt. Eltern bildeten eine wichtige Stütze. Besonders im Kleinen, im Breitensport, fiebern Eltern mit. Am Spielfeldrand zu stehen, „macht vieles mit ihnen“, sagt die Sportpsychologin Valeria Eckardt, 31. Ist es also erklärbar, dass Eltern den Schiri ohrfeigen, andere Eltern „Arschloch“ nennen oder zu gegnerischen Spielern sagen: „Zieh dir mal den Nagel aus dem Kopf?“
Eltern erleben die Emotionen ihrer Kinder während eines Spiels mit, zeigen Studien. Valeria Eckardt hat zu diesem Thema an der deutschen Sporthochschule Köln promoviert. Ihr Fokus lag auf Erfahrungen, die Eltern mit Stress am Spielfeldrand und in Zusammenarbeit mit Trainern machen.
Negative Berichte über Eltern, die bei Spielen des Kindes ausrasteten, machten Valeria Eckardt neugierig. Vergangenes Jahr publizierte sie einen Beitrag mit dem Titel: „Meine Tochter wurde ausgewechselt und ich fühlte mich selbst aus dem Spiel genommen“. Darin beschreiben neunzig Eltern Situationen, die sie während Fußballspielen als stressig erlebten.
Die meisten davon entfallen auf Situationen, an denen das eigene Kind beteiligt ist: 32,2 Prozent. Besonders fühlen sich Eltern gestresst, wenn das eigene Kind gefoult und verletzt wird. Sie betonen, dass es sich dabei nicht um kleinere Verletzungen handelt, sondern um gravierende Schäden mit einem Krankenhausaufenthalt und dem Ausfall für das nächste Spiel.
Stress bei mangelnder Spielzeit
Die Eltern fühlten sich in diesen Momenten hilflos, machten sich Sorgen und stellten das Fußballspielen ganz in Frage. Ein Vater sagte: „Man muss sich zusammenreißen, dann nichts zu sagen oder dem Kind zu Hilfe zu eilen. Es tut einem selber weh, wenn dem eigenen Kind Schmerzen zugefügt werden und man fragt sich, ob es das wert ist.“
Auch wenn das eigene Kind nicht so viel Spielzeit wie erhofft erhält, löst das Stress aus. Besonders dann, wenn Trainer vorher mehr Einsatzzeit versprochen haben und das Kind „am Vorabend als Nr. 1“ bezeichnet haben, wie jemand sagte. 16,7 Prozent der Stresssituationen sind Momente, in denen Eltern beobachten, wie andere Eltern agieren. Eine Mutter sagte: „Eltern schimpften laut gegen die gegnerischen Spieler. Trotz harter Spielweise der Gegner fand ich es peinlich, dass Eltern sich lauthals beschwerten und nicht dem Schiedsrichter die Führung überließen.“
Für Anweisungen ist nur der Trainer zuständig
In der Studie ging es auch darum, welchen Einfluss das Verhalten der Eltern auf das Spiel hat. Ein Teilnehmer sagte: „Extrem starker Einfluss von außen durch Eltern während eines Turniers. Es waren durchweg Eltern, die mit starker Vulgärsprache eine extreme Unruhe in die Spiele als auch in die Menge der außenstehenden Eltern und Betreuer gebracht haben. Der sportliche Aspekt geriet stark in den Hintergrund, die Kinder wurden zu unfairem Verhalten animiert.“ Und ein Vater: „Eltern beleidigen Kinder. Man schreitet ein und verteidigt die eigenen Kinder, weil man sich persönlich angegriffen fühlt.“
Eltern könnten nur dann ausreichend für ihre Kinder da sein, wenn sie ihre eigenen Emotionen im Griff haben. Um das zu erreichen, sei hilfreich, sich am Spielfeldrand mit anderen Eltern – oder einem Begleiter – über die eigenen Erfahrungen auszutauschen. Wenn es dann mal zu spannend ist: fünfmal tief durchatmen oder fünf Dinge aufzählen, die man sehen oder hören kann. „Wenn man ein spannendes Spiel gar nicht aushält, dürften Eltern weggehen. Sie sollten davor jedoch mit ihrem Kind sprechen und es auf diesen Fall vorbereiten. Damit das Kind nicht denkt, es liegt an ihm.“
Aus Befragungen von Kindern weiß Valeria Eckardt: Ihnen ist wichtig, dass ihre Eltern sie vor und während des Spiels unterstützen. Das heißt: Tasche packen, pünktlich sein, anfeuern – und zwar die ganze Mannschaft. „Die Eltern sollten ihren Fokus auf das Bemühen des Kindes legen und weniger auf das Endergebnis. Darüber kann die langfristige Freude am Sport gefördert werden.“ Leichter gesagt, als getan. Eltern, die viel Zeit und Geld in ihre Kinder investieren, erwarteten, dass es sich auch rentiert, wie eine Studie aus den Vereinigten Staaten herausgefunden hat.
„Weghören, weggehen“
Thomas Schmidt, 58, trainiert seit vielen Jahren Kinder, die zwischen fünf und zehn Jahre alt sind, derzeit die F-Jugend der FT Gern. Der Verein also, dessen Spielereltern in die Schlägerei involviert waren. Thomas Schmidt sah den Tumult von weit weg, rügte nachher Vater Steffen Dobler. Man dürfe nicht anfangen zu schubsen, sondern müsse „weghören, weggehen“. Der ehrenamtliche Trainer und von Beruf Informatiker hat selbst drei Kinder und sagt: In jeder Mannschaft gibt es zwei, drei ehrgeizige Väter und Mütter. Die riefen Sprüche rein wie „Haut sie um!“. Die Eltern seien „so drin, so auf ihr Kind fokussiert, meinen, wir spielten Champions League“. Einmal, bei einem Spiel, stand auf einmal ein Vater direkt hinter Thomas Schmidt – anstatt das Spiel von hinter der Bande aus zu verfolgen.
Ein anderes Mal rechnete ein Vater vor, dass sein Kind nur 15 Minuten, andere Kinder aber 17 Minuten auf dem Feld gestanden haben. Kommt öfter vor. Der Trainer führt extra eine Liste mit den Einsatzzeiten, um sich rechtfertigen zu können. Einen Spieler wechselte Thomas Schmidt hingegen bewusst vorzeitig aus. Er sollte zu seinem Vater laufen, weil der immer wieder Kommandos hineinrief und seinen Sohn ablenkte: „nach vorne laufen, dribbeln, schieß“. Vater und Sohn sollten das dann außerhalb des Spielfelds klären.
Wenn Eltern ihre Kinder bei der FT Gern anmelden, lässt Thomas Schmidt einen Verhaltenskodex unterschreiben. Darin heißt es: „Alle Erwachsenen haben eine Vorbildfunktion“, „Sportliche Anweisungen kommen ausschließlich vom Trainer.“ Hervorgehoben ist der Satz: „Während des Spiels sind Eltern nur Zuschauer!“ Sie versichern mit ihrer Unterschrift, sich respektvoll gegenüber Gegner und Schiedsrichter zu verhalten, nur positiv anzufeuern, keine Kritik gegenüber der eigenen Mannschaft zu üben.