Herr Maas, Kinder haben heute so viele Spielsachen, viel mehr als früher. Warum ist ihnen trotzdem langweilig?
Weil es zu viele sind. Wenn ein Kind zum Beispiel eine Puppe hat, dann gibt es ihr verschiedene Stimmen, entwickelt mit seiner Fantasie Spiele damit. Hat es zu viele davon, ist es überfordert. Diese Kreativität entsteht nicht mehr, die Dinge nutzen sich ab. Nehmen wir eine Puppe, die schreien, weinen, lachen und sprechen kann. Hat das Kind diese Optionen ausprobiert, verliert die Puppe an Attraktivität. Fantasie entwickelt sich hier nicht.
Oft springen Eltern ihren Kindern bei, wenn ihnen langweilig ist, und machen Vorschläge, was sie tun könnten. Sie sagen, damit schadeten sie ihren Kindern eher, als dass sie sie fördern. Warum?
Die Kinder lernen sehr schnell, dass die Umgebung sie bespielt, dass die Eltern die Entertainer sind. Wenn es mir langweilig ist, dann sind die Eltern quasi Schuld. So ein Reflex kann kommen. Oft passiert das ja auch in Situationen, in denen die Eltern gerade nicht können, wie im Auto. Und da passiert dann das Gleiche: Sie reichen ihren Kindern das Tablet und dieses unterhält das Kind dann. Bei Social Media werden ihm immer wieder neue Videos vorgespielt. Es lernt nicht, etwas aus der Umgebung heraus zu gestalten.
Das heißt, die Eltern müssen diese Quengelphase einfach mal aushalten?
Ja, unbedingt. Sie müssen oft nur fünf bis zehn Minuten warten, und die Kinder entwickeln ein eigenes Spiel. Diese intrinsische Motivation, die das Kind aus sich selbst heraus entwickelt, wird geschwächt, wenn Eltern zu schnell reagieren. Will das Kind die Erwachsenen ins Kaufladen-Spiel einbinden, wunderbar. Doch die Idee sollte idealerweise aus ihm heraus kommen. Wir Erwachsene haben eine andere Fantasie und geben meist unbewusst zu viel vor.
Machen wir es konkret. Ein Kind quengelt: „Mir ist soooo langweilig“. Wie sollten Eltern darauf reagieren?
Toll. Jetzt bin ich gespannt, was du draus machst. Dann zieht man sich zurück. Wir tun uns sehr schwer damit, das einfach mal auszuhalten – und am Ende sind wir die Ungeduldigen.
Welche Folgen kann es für die Persönlichkeit des Kindes haben, wenn es solche Frustzeiten nicht erlebt?
Wenn Kinder weniger Frustrationen erleben, dann entwertet das auch das Positive. Wenn später etwas nicht wegwischbar ist zum Beispiel durch die Eltern, dann zerbrechen diese Kinder in der Jugend oft schneller, weil sie schlicht untrainierter sind, die Hürde alleine zu bewältigen. Das ist nicht zu unterschätzen. Ein gewisser Frust gehört dazu, gerade auch in der Kindheit. Wer Frust erlebt, kann die Momente ohne Frust viel mehr wahrnehmen und genießen. Wenn ich immer nur gelobt werde, dann ist Lob die Normalreaktion. Kritik ist dann oft etwas Fremdes, man nimmt sie zu ganzheitlich wahr. Müssen Kinder konstruktiv Herausforderungen überwinden, dann macht sie das stark und mutig.
Sie beschreiben in Ihrem Buch den Kindergeburtstag eines Fünfjährigen. Die Eltern haben alles durchgeplant, von der Einladungskarte bis zum Ablauf des Festes. Was ist das Problem dabei?
Es muss nicht alles durchgeplant sein. Ab einem gewissen Alter können die Kinder auch allein spielen, und brauchen die Eltern nicht permanent um sich herum. Wir haben bei vielen Studien beobachtet, als wir auch Kindergeburtstage besucht haben, dass Eltern Kinder aus vertieftem Spielen herausreißen mit ständigen Aktionen: Um 14 Uhr kommt die Super-Torte, um 16 Uhr dann der Super-Clown. Kinder bräuchten dieses ständige Aktions-Topping gar nicht. Idealerweise reißt man sie nicht ständig aus ihrer Spielphase.
Langeweile und Frust fühlen sich für das Kind erst einmal unangenehm an. Welche positiven Folgen für die Entwicklung können diese Gefühle haben?
Das Kind muss in dieser Situation versuchen, die Dinge, die es in seiner Umgebung vorfindet, mit zu nutzen, um etwas zu gestalten. Das ist das Wunderbare. Aus Langeweile kann sich Kreativität, Empathie und Innovationskraft entwickeln. Deswegen ist es so wichtig, aus dem vermeintlichen Nichts etwas zu machen. Erleben die Kinder öfter, dass ihnen das gelingt, dann stärkt das auch ihr Selbstbewusstsein. Sie wissen dann, dass es in Momenten der Langeweile an ihnen liegt, etwas zu entdecken und dass nicht die Umgebung an diesem Gefühl Schuld ist.
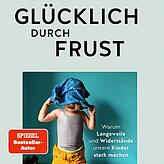
Sie haben es bereits angesprochen: Der Klassiker ist, dass Eltern beim Autofahren ihren Kindern das Tablet nach hinten reichen. Wie könnten sie diese Situation anders gestalten?
Wir haben früher Stadt Land Fluss gespielt. Man kann zusammen singen, man kann sich unterhalten. Das findet viel zu selten statt. Wir sind einfach mehr gestresst als früher, da greift man schnell zum Tablet. Die Kinder fordern das auch ein. Mittlerweile sind Orte der Langeweile so stark auf diese Geräte konditioniert, dass wir automatisch aufs Handy oder Tablet schauen. Das heißt, die Kinder steigen schon mit dem Gefühl ins Auto, ich muss nur fragen, dann krieg ich es auch.
Die Eltern meinen es ja eigentlich gut...
Natürlich. Trotzdem brauchen sie auch am Wochenende nicht in Aktionismus zu verfallen, nur weil das Kind die ganze Woche bis 17 Uhr in der Kita ist, weil beide Eltern arbeiten. Grundschulkinder machen nachmittags Karate, gehen in die Musikschule und wer weiß was noch. Wir gönnen ihnen gar nicht mehr runterzufahren, sondern pressen so viele Aktivitäten wie möglich in die Woche. Damit geht die Langeweile und mit ihr auch die Fantasie unter. Doch Kinder brauchen Zeit, Dinge zu verarbeiten, und Zeit, zu sich zu finden – und dafür brauchen sie Orte der Ruhe.
Müsste man also Räume für Langeweile schaffen?
Räume für Langeweile zu schaffen, wäre eine tolle Gegenbewegung. Ich meine natürlich nicht, dass man gar nichts mit dem Kind macht, es nicht fördert und herausfordert. Aber nur so viel, wie für das Kind gut ist. Ein Mehr bedeutet eben nicht, dass beim Kind auch mehr herauskommt. Es ist ja kein Projekt oder eine Checkliste.
Sie haben Ihren achtjährigen Neffen gefragt, wie er sich fühlt, wenn ihm langweilig ist. Was hat er gesagt?
Interessant war, dass die Ratschläge der Eltern ihm, wenn ihm langweilig war, gar nichts gebracht haben. So kam er auf die Idee eines Waffenclubs – das war sein Thema. Unter Waffen versteht er, wenn er aus einem Stock, den er findet, zum Beispiel eine Pistole zaubert.
Manchmal reagieren Eltern auch genervt, wenn das Kind vor Langeweile quengelt. Da bringen Sie Teppichkonferenzen ins Spiel. Wie funktioniert das?
Meine Tochter Samira und ich setzen uns dann auf den Boden. Gerne tausche ich mit ihr die Rollen und sage: Ich bin die Samira, du bist der Papa, und mir ist langweilig. Was soll ich machen? Das klappt gut, weil die Kinder gerne die Erwachsenenrollen spielen. Dabei kommen nette Sachen heraus. Man kann auch einen Gegenstand nehmen und sagen: Dem ist langweilig, was könnte der alles sein? Den Kindern ein paar Impulse geben, sie aber dann auch selbst kommen lassen, das ist der Trick.








