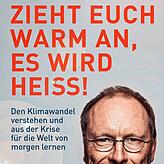Herr Plöger, Deutschland hat wieder einen extrem trockenen Frühling erlebt, im letzten Jahr brannten nicht nur in Australien und Brasilien die Wälder. Dann kam Corona. Interessiert sich heute noch jemand für den Klimawandel?
Oh ja, die Leute interessieren sich mehr denn je dafür! Das sehe ich unter anderem an den vielen E-Mails, die mich dazu jeden Tag erreichen. Das wachsende Interesse liegt daran, dass der Klimawandel vor allem seit dem Rekordsommer 2018 mit Hitze, Dürre, Waldbränden und Ernteausfällen auch bei uns mittlerweile konkret spürbar geworden ist. Natürlich wurde zuletzt jedes Thema durch Corona überlagert, denn die Pandemie betrifft jeden. Aber das tut der Klimawandel auch!
Sowohl der Klimawandel als auch das Corona-Virus könnten Millionen Menschenleben kosten. Trotzdem reagieren Gesellschaft und Politik unterschiedlich auf die Probleme. Warum?
Es liegt wohl vor allem daran, dass wir die Bedrohung durch Corona als sehr konkret wahrnehmen. Meine Familie, meine Freunde oder ich selbst könnten erkranken oder sogar an der Krankheit sterben. Die Gefahr durch den Klimawandel ist auch real, aber oft nehmen wir diese nicht als so konkret wahr. Noch haben wir eher das Gefühl, dass vielleicht irgendwann, irgendwem, irgendwo irgendetwas passieren wird.

Ist das der einzige Unterschied?
Nein, es liegt auch an der Zeitspanne. Die Corona-Krise ist wie ein Asteroiden-Einschlag in Zeitlupe. Wir haben ein paar Wochen, um uns vorzubereiten, um das Schlimmste zu verhindern. Das ist eine Zeitspanne, die unserem Planen und Handeln sehr entgegenkommt. In Deutschland haben wir diese Zeit sehr gut genutzt. Der Klimawandel hingegen ist wie ein Asteroiden-Einschlag in Superzeitlupe. Die Auswirkungen unseres Handelns oder Unterlassens werden erst in einigen Jahrzehnten vollständig spür- und sichtbar. Viele von uns und unsere Kinder und Enkel werden das noch erleben.
In der Corona-Krise hat die Politik schnell Maßnahmen ergriffen, die die Freiheit der Menschen sehr stark eingeschränkt haben. Die meisten haben das mitgetragen. Ginge das nicht auch beim Klimawandel?
Dafür sind die Auswirkungen des Klimawandels einfach noch nicht dramatisch genug zu spüren. Wenn wir in einer apokalyptischen und dystopischen Zeit (eine Zeit negativer Utopien, Anm. d. Red.) leben würden, in der wir beispielsweise jedes Jahr eine verheerende Dürre hätten, wäre die Bereitschaft, darauf mit drastischen Maßnahmen zu reagieren, sicher größer. Aber genau das gilt es natürlich zu verhindern.
Politiker, die bei Corona versagen, werden möglicherweise nicht wiedergewählt, weil die Todesraten steigen. Die Folgen der Klimapolitik zeigen sich erst später . . .
Ja, und das ist ein Problem. Besonders gut lässt sich das in den USA betrachten. Trump hat zunächst so getan, als beträfe das Coronavirus die USA nicht. Die fatalen Folgen sind bekannt. Beim Klimawandel macht er genau dasselbe und tut auch hier so, als gäbe es das alles nicht, und auch das wird fatale Folgen haben! Gleichzeitig weiß er übrigens ganz genau, dass sich das Klima verändert. Sonst würde er nicht seinen Golfplatz in Irland für viel Geld gegen den Anstieg des Meeresspiegels sichern. In seiner Welt dreht sich offenkundig alles – so wie es bei vielen Populisten der Fall ist – nur um ihn selbst.

In der Corona-Krise hat die Politik auf die Wissenschaft gehört. Virologen wie Christian Drosten sind so zu verehrten und zugleich verhassten Stars aufgestiegen. Könnten Klimaforscher die neuen Virologen werden?
Klimaforscher wie Professor Hans Joachim Schellnhuber, der lange das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung leitete, oder Professor Mojib Latif sind mittlerweile auch außerhalb der wissenschaftlichen Community bekannt, auch wenn sie aktuell natürlich nicht so populär wie Professor Drosten sind. Doch sie teilen sein Schicksal. Wenn sie der Gesellschaft und der Politik aufgrund wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse empfehlen, dass wir unser Verhalten ändern müssen, um eine Katastrophe zu verhindern, werden auch sie von bestimmten Gruppen diskreditiert, beschimpft, beleidigt oder sogar bedroht.
Die für November geplante 26. Weltklimakonferenz wurde wegen Corona um ein Jahr verschoben. Braucht die Welt diese Mammutkonferenzen nicht mehr?
Wir brauchen bei den Weltklimakonferenzen eine neue Systematik. Bislang kommt nur das ins Abschlusskommuniqué, auf das sich die mehr als 190 Staaten, die die Klimarahmenkonvention unterschrieben haben, einstimmig einigen können. Einstimmigkeit von mehr als 190 Ländern! Das führt automatisch zum allerkleinsten gemeinsamen Nenner. Die Bremser bestimmen deshalb jahrein, jahraus diesen ganzen Prozess. Besser wäre es, wenn die Länder, die in Sachen Klimaschutz mehr wollen, vorangehen. Als sechstgrößter Emittent von Treibhausen auf dieser Welt möchte und muss Deutschland zu dieser Gruppe zählen.
Sehen Sie in der Corona-Krise die Chance, dass es zu einem klimafreundlicheren Kurs der Wirtschaft kommt?
Während der coronabedingten Entschleunigung haben sich viele Menschen damit beschäftigt, ob wir tatsächlich mit unserem Immer-schneller-höher-weiter-Hyperkonsum fortfahren wollen. Viele fragen sich: Wo wollen wir damit hin? Natürlich haben die Einschränkungen für viele Menschen zu großen Problemen geführt, und es ist wichtig, dass die Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Aber ich habe die Hoffnung, dass die Krise auch im positiven Sinn eine Zäsur sein kann.
An was denken Sie da?
Ich hoffe, dass Umwelt- und Klimaschutzinteressen im Rahmen des neuen Green Deals, den EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgestellt hat, eine wichtige Rolle spielen werden. Ich finde es ein gutes Signal, dass dem reflexartigen Ruf der deutschen Autoindustrie nach Abwrackprämien für Verbrenner nicht nachgegeben wurde. Das liegt sicher auch daran, dass eine immer umweltbewusstere Bevölkerung das nur schwer hätte nachvollziehen können.
Brauchen wir mehr Regeln, Vorschriften und Verbote, um den Klimawandel zu verlangsamen?
Ja! Ohne das wird es nicht funktionieren. Die Erfahrung zeigt: freiwillig werden die meisten Menschen ihr Verhalten nicht ändern. Die Gier, die zur Ausbeutung der Natur und somit zum Klimawandel führt, wird nicht einfach so überwunden werden. Das liegt auch daran, dass es für das globale Klima keinen Unterschied macht, wenn Einzelne sich vorbildlich verhalten, Andere jedoch nichts für den Klimaschutz tun. Wenn hingegen verbindliche Regeln alle Menschen zum Klimaschutz verpflichten, können wir viel erreichen.
Egal, wie sie beschlossen werden – Verbote sind nie populär.
Das ist mir klar. Es wird immer Menschen geben, die Verbote als Eingriff in ihre Freiheit sehen. Ich bin selbst ein großer Freund der Freiheit. Ich will sie keinesfalls unnötig einschränken. Aber wir müssen auch bedenken: Die Freiheit des einen bedeutet oft die Unfreiheit des anderen. Wenn wir den Klimawandel durch unser Verhalten beschleunigen, leiden darunter nicht nur Pflanzen und Tiere, sondern auch Menschen. Zunächst sind dies vor allem Menschen in Entwicklungsländern, die mit ihren geringen Emissionen zwar kaum etwas zum Klimawandel beitragen.
Wollen Sie, dass in Deutschland Inlandsflüge verboten werden?
Nein, aber Inlandsflüge müssen teurer werden, damit die viel klimafreundlichere und oft fast genauso schnelle Bahn nicht ins Hintertreffen gerät. Es stimmt doch etwas nicht, wenn man aus der Innenstadt in München 70 Euro für das Taxi zum Flughafen zahlt, dann aber für 29 Euro nach Hamburg fliegt! Auch Auslandsflüge müssen teilweise teurer werden. Aber es ist wichtig, dass es dabei sozial gerecht zugeht. Es darf nicht sein, dass sich nur noch reiche Leute, die aufgrund ihres Lebensstils in der Regel ohnehin höhere Emissionen haben, Reisen leisten können und alle anderen zu Hause bleiben müssen.

Anfang des Jahres wurde das Lied „Meine Oma ist ne alte Umweltsau“ als Ausdruck eines Generationskonfliktes im Kampf gegen den Klimawandel diskutiert. Dann kam Corona und viele junge Menschen haben sich eingeschränkt, um die Leben Älterer zu schützen . . .
Ich würde mich freuen, wenn es zu einem von Professor Schellnhuber vorgeschlagenen Corona-Klima-Generationen-Vertrag käme. Die jungen Menschen schränken sich ein, um die Risikogruppe der Älteren vor dem Virus zu schützen, und die Älteren engagieren sich stärker für den Klimaschutz, wovon besonders die jüngeren Generationen profitieren würden. Der Umweltsau-Song ist für ein konstruktives Miteinander der Generationen nicht gerade förderlich. Natürlich gibt es die zu schützende künstlerische Freiheit, aber ich glaube, es bringt nichts, wenn Kinder jetzt mit dem Finger auf ihre Oma zeigen. Das gießt nur unnötig Öl ins Feuer und für so was ist keine Zeit. Wir haben Wichtigeres zu tun.