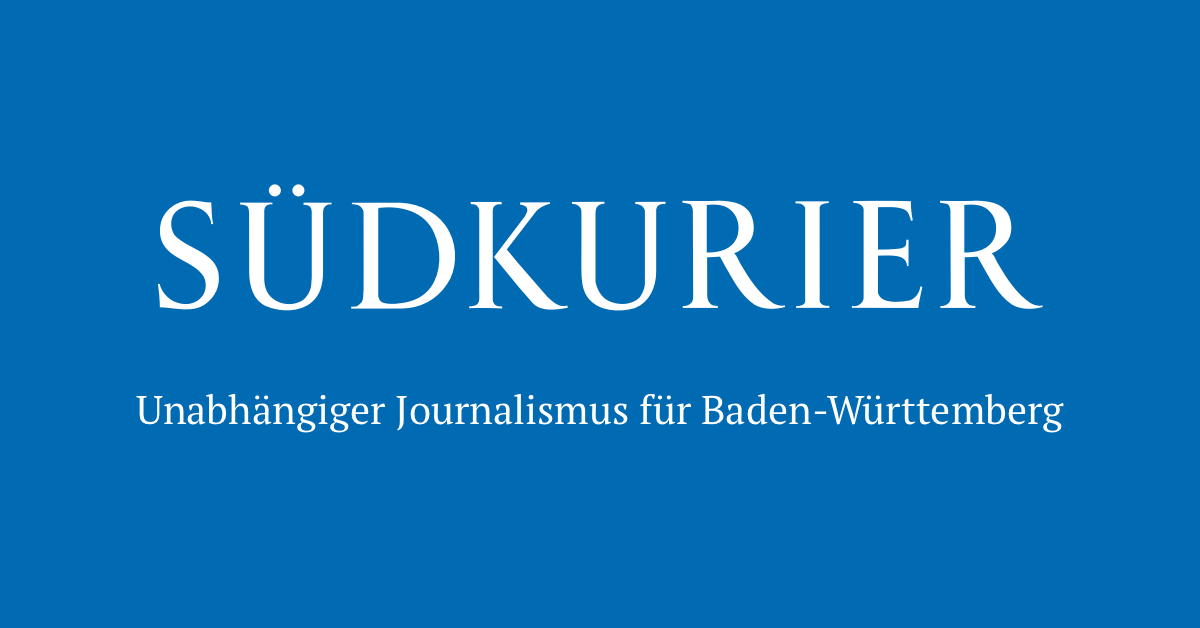162 Seiten ist der Koalitionsvertrag der zweiten Auflage von Grün-Schwarz im Land dick. Vieles davon wird die Menschen in der Region betreffen, so wie alle Menschen im Land – von den Plänen zum schnellen Internet bis zum dichteren Busverkehr-Takt, von der Auto-Strategie der Landesregierung bis zu den Schulplänen. Aber Hochrhein, Schwarzwald und Bodenseeregion werden auch an einigen Stellen ganz explizit erwähnt. Der SÜDKURIER hat sich genauer angeschaut, was an Plänen für die Region im Vertrag drinsteckt:
1. Das unangenehme Thema Fluglärm
Beim schier endlosen Thema Flugverkehrsbelastung durch den grenznahen Flughafen Zürich geht die Landesregierung in eine neue Runde. In dem entsprechenden Passus heißt es:
„Wir setzen uns mit Nachdruck dafür ein, die Flugverkehrsbelastungen durch den Flughafen Zürich in der Region Südbaden/Hochrhein deutlich zu reduzieren. Wir wollen gemeinsam mit dem Bund und der Region zu einer einvernehmlichen Lösung mit der Schweiz gelangen. Wir bekennen uns dabei zu den Inhalten der ,Stuttgarter Erklärung‘. Die Landesregierung wird sich gegenüber dem Bund insbesondere für eine Begrenzung der An- und Abflüge auf maximal 80.000 pro Jahr einsetzen.“
Damit schreibt die Landesregierung fort, was sie schon 2011 zum ersten Mal in einen Koalitionsvertrag einfließen ließ. Damals herrschte noch eine grün-rote Koalition, und die Formulierungen waren weniger konkret. Eine Lösung gibt es bis heute nicht. Zwar hat die Corona-Pandemie zur Folge, dass deutlich weniger Flugzeuge am Himmel über Südbaden sind. Doch das sollte sich schnell wieder ändern, sobald das Reisen wieder Konjunktur hat.
Auch diesmal scheint die Landesregierung auf dem Papier bereit zu sein, sich dem unangenehmen Thema zu widmen, das beim Schweizer Nachbarn nicht gut ankommt. Allerdings hat Stuttgart in den zurückliegenden Monaten keine Anstalten gemacht, sich um eine Lösung im Sinne des Koalitionsvertrages zu bemühen. Im Gegenteil, selbst an einem Weg über die Espoo-Konvention, bei der die Schweiz zu einer Umweltverträglichkeitsstudie verpflichtet wäre, war Stuttgart aus Gründen der guten Nachbarschaft nicht interessiert. So heißt es in einer Stellungnahme des Bundesumweltministeriums an die Unece in Genf, die dem SÜDKURIER vorliegt: „Die baden-württembergische Landesregierung ist immer noch der Meinung, dass ein Espoo-Verfahren gegenwärtig nicht angewendet werden soll.“
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach Espoo könnte nach Ansicht Wolfgang Schus von der Bürgerinitiative Flugverkehrsbelastung am Hochrhein die Schweiz zwingen, sachgerecht und vernünftig zu begründen, warum sie für An- und Abflüge den deutschen Luftraum zwingend braucht. Schu hat gemeinsam mit seinen Mitstreitern erreicht, dass sich die UNECE des Themas angenommen hat. Eine Überprüfung der Vorgehensweise der beiden Staaten in dieser Sache läuft. „Wir rechnen jetzt damit, dass das Ergebnis der Prüfung in Kürze erfolgt.“ Seine Erwartungen an die Koalitionspartner sind eindeutig. Er rechne jetzt endgültig noch in dieser Legislatur mit einer Lösung des Problems.
2. Wie geht es weiter mit den Atomendlagerplänen?
Auch bei einem weiteren Streitthema, den möglichen Atomendlagern auf deutscher und Schweizer Seite, verspricht der Koalitionsvertrag der Region Rückhalt. Allerdings lassen die Koalitionäre in den Formulierungen wenig kritische Distanz anklingen. So heißt es zur Standortsuche in Deutschland: „Die Koalitionspartner bekennen sich zur geologischen Tiefenlagerung hochradioaktiver Abfälle und unterstützen das begonnene Standortauswahlverfahren. Hierfür bedarf es einer Stärkung der Kompetenz und Kapazität im Vollzug des Geologiedatengesetzes.“

Mit Blick auf die schon weit fortgeschrittenen Pläne der Schweiz für ein Atomendlager in Grenznähe heißt es: „Das Land erwartet von der Schweiz, die dortige Standortauswahl unter gleichberechtigter Teilnahme deutscher Betroffener fortzusetzen und eine Entscheidung für den nach internationalen Standards geologisch bestgeeigneten Standort zu treffen.“
Von Transparenz ist das Suchverfahren in der Schweiz allerdings noch weit entfernt: In einer Stellungnahme der drei betroffenen deutschen Landkreise Waldshut, Konstanz und Schwarzwald-Baar an das Berner Bundesamt für Energie (BFE) fordern diese bei dem nächsten Schritt zur Ausarbeitung des Rahmenbewilligungsgesuchs zusätzlich Informationen ein. „Die bisherigen Uberlegungen des BFE und der Nagra zu diesem Verfahrensschritt gewahrleisten kein transparentes und nachvollziehbares Verfahren.“
Der regionalen Bürgerinitiative Klar Deutschland, die beide Standortsuchverfahren kritisch begleitet, reicht nicht, was im Koalitionsvertrag steht. Baden-Württemberg liege beim Suchverfahren in Deutschland weit hinter Bundesländern wie Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen, die sich bereits deutlich positioniert hätten, sagt Klar-Sprecher Thomas Weber aus Überlingen. Zudem habe es bisher erst eine Veranstaltung dazu im Land gegeben. „Seither herrscht Funkstille.“ Baden-Württemberg hätte das wissenschaftliche Fachwissen. „Seine Expertise sollte es möglichst bald einsetzen und vor allem die Bevölkerung über die von der BGE (Bundesgesellschaft für Endlagerung) erklärten Teilgebiete im Hegau und im übrigen Land informieren.“
3. Hat das leidige Stempeln der Ausfuhrscheine bald ein Ende?
„Die Landesregierung wird sich bei der Bundesregierung dafür einsetzen, dass ein digitaler Ausfuhrschein in Form einer App geschaffen wird, um die Mehrwertsteuererstattung an der Schweizer Grenze zu digitalisieren“, heißt es im Koalitionsvertrag. Das klingt erstmal gut, aber was bedeutet es?
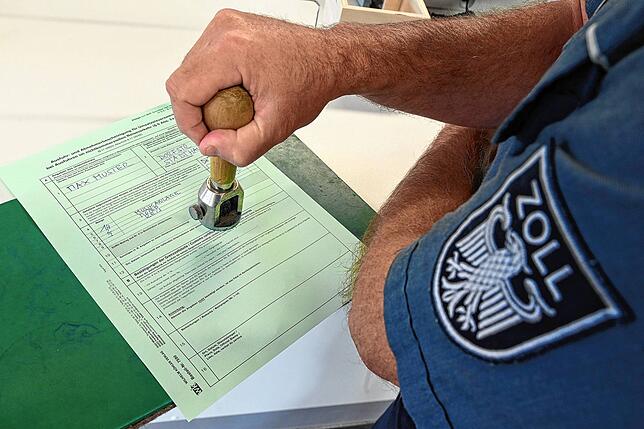
Dass sich das Land für eine digitale Lösung bei der Abfertigung der Ausfuhrscheine einsetzen will, wird gleich drei Gruppen besonders freuen. Erstens einheimische Kunden, die hierdurch an den Supermarktkassen kürzer warten müssten. Zweitens den Zoll, für dessen Beamte und Mitarbeiter sich das leidliche Stempeln der Ausfuhrscheine erledigt hätte. Drittens Schweizer Kunden, für die der Grenzübertritt schneller gehen würde.
Auch wenn die Zahl seit einigen Jahren leicht rückläufig ist, wurden im letzten Jahr vor Corona 2019 allein durch das Hauptzollamt Singen knapp zehn Millionen grüne Zettel bearbeitet. Allerdings steckt der Teufel im Detail: Das Land hat in dieser Sache wenig zu melden, kann allenfalls Bedürfnisse beim Bund anmelden. Dort gibt es zwar ebenfalls seit Jahren Pläne für eine Ausfuhrschein-App. Wann genau sie kommt? Unklar. Nur was ihre Entwicklung und der Betrieb allein bis 2025 mindestens kosten soll weiß man schon: 25 Millionen Euro.
4. Wasserstoff-Pläne am Hochrhein
Wasserstoff als Energieträger ist eines der Zukunftsthemen beim Übergang Deutschlands in die CO2-Neutralität. Im Rahmen seiner Wasserstoffstrategie will der Bund neun Milliarden Euro in Forschung und den Ausbau der Infrastruktur stecken. Und auch die EU hat im Rahmen ihres Green Deal Milliarden für das Thema reserviert. Weil die Fleischtöpfe gefüllt sind, steigen nun auch die Bundesländer bei dem Thema ein: „Wir werden prüfen, inwieweit die Weiterentwicklung des grenzüberschreitenden ,Wasserstoff Valley Hochrhein‘ und die Gründung eines ,Ultraeffizienzzentrums für H2‘ als deren zentrales Element unterstützt werden kann“, heißt es im Koalitionsvertrag. Ziel sei es, die vorhanden Kompetenzen und Erfahrungen für diese Schlüsseltechnologie in der Region Hochrhein grenzüberschreitend zu bündeln.

Was ist davon zu erwarten? Kern des Leuchtturmprojekts könnte der Spezialchemieriese Evonik in Rheinfelden werden. Er produziert seit Jahrzehnten Wasserstoff, nur eben aus klimaschädlichem Erdgas, nicht aus Öko-Strom. Abnehmer sind vor allem große Chemiefirmen, die entlang des Rheins im Dreiländereck traditionell angesiedelt sind. Deren Bedarf an sauberem – grünen – Wasserstoff wird in den kommenden Jahren massiv ansteigen.
Zum Vorteil der Region: Es gibt große Wasser- und Pumpspeicherkraftwerke, die den nötigen Ökostrom liefern könnten. Zudem betreibt die EnBW-Tochter Energiedienst in Grenzach-Wyhlen seit 2019 einen der bundesweit größten Elektrolyseure. Das ist eine Anlage, die aus Wasserkraft bereits heute grünen Wasserstoff herstellt. Bei einem Besuch der Region sagte der Wasserstoff-Beauftragte der Bundesregierung, Stefan Kaufmann, im Herbst 2020 „das könnte ein echtes Leuchtturmprojekt für die Energiewende werden – mit einer Ausstrahlung weit über den Hochrhein hinaus.“
5. Die Bodenseeregion im Einsatz für Umwelt und Klima
Der Bodensee findet mehrfach Erwähnung im Koalitionsvertrag. Zum Beispiel unter der Überschrift Umweltschutz. Da heißt es: „Der Bodensee ist Trinkwasserspeicher für rund fünf Millionen Menschen und eines unserer wertvollsten Ökosysteme. Wir wollen ihn daher weiterhin besonders schützen – auch im Hinblick auf den Erhalt der Biodiversität.“
Was das konkret bedeutet, steht im nächsten Satz: Die Landesregierung sehe keine Grundlage für eine Abweichung vom Verbot von Netzgehegen für die Fischzucht, wie es in den Bodenseerichtlinien der Internationalen Gewässerschutzkommission für den Bodensee (IGKB) verankert sei. Also ist mit Fischgehegen auch in Zukunft nicht zu rechnen. Die Genossenschaft „Regio Bodensee Fisch“ hat ihre Pläne aber ohnehin kürzlich ad acta gelegt.

Spektakulär mutet die folgende Ankündigung an: „Die Bodenseeregion
soll sich zu einem CO2-neutralen Kultur-, Natur- und Wirtschaftsstandort weiterentwickeln. Wir wollen dabei klimafreundliche, grenzüberschreitende Verkehrskonzepte rund um den See entwickeln und forcieren. Das Land wird sich weiterhin aktiv im Rahmen der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK) in die Gestaltung der Zusammenarbeit in der Grenzregion einbringen.“
Sehr konkret sind die Planungen aber noch nicht. Beim Schiffsverkehr gibt es bereits erste Beispiele für alternative Antriebe. Das könnte man erweitern. Die Ausgestaltung und Umsetzung soll laut Andreas Schwab, CDU-Europaabgeordneter, von der Internationalen Bodenseekonferenz und im neuen Interreg-Programm Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein 2021-2027 erfolgen.