Das Umweltministerium Baden-Württemberg schlägt Alarm. Die Behörde hat aktuell eine Studie zur Sicherheit der Trinkwasserversorgung veröffentlicht. Kernaussage: Schon jetzt haben viele Gemeinden im Land mit Trockenheit zu kämpfen – bis 2050, so das Ministerium, könne die Hälfte aller Kommunen in Baden-Württemberg den Bedarf zu Spitzenzeiten nicht mehr decken – dies als Folge des Klimawandels.
Wie sieht die Situation bei uns aus? Hat auch die Stadt Bad Säckingen ein Problem mit der Versorgung oder bekommt sie eines? Wir haben bei den Stadtwerken nachgefragt.

Zwischenfazit mit alarmierendem Ergebnis
Die Studie basiert auf dem „Masterplan Wasser“ der Landesregierung. Danach wird derzeit die Versorgungsstruktur aller Kommunen im Land geprüft. Zwischenfazit nach 25 von 44 Landkreisen ist eben jenes bedenkliche Ergebnis, dass das Umweltministerium jetzt aktuell im Juli veröffentlicht hat. Die Landkreise Waldshut und Lörrach und damit auch die Stadt Bad Säckingen, würden aktuell noch geprüft. Sie gehören laut Pressesprecherin Claudia Hailfinger vom Umweltministerium zur Prüfcharge 4 und 5. Diese seien bis 2026 abgeschlossen, dann lägen auch die Ergebnisse für den Hochrhein vor.
Was sagen die Stadtwerke zur Versorgungslage?
Vorab hat der SÜDKURIER jedoch direkt beim Wasserversorger Stadtwerke Bad Säckingen nachgefragt. Der technische Leiter Philipp Stiegeler kennt die Situation am Wassermarkt und die Herausforderungen durch den Klimawandel.
Die gute Nachricht für die Stadt: Das Bad Säckinger Grundwasservorkommen habe sich auch über die vergangenen, teilweise sehr heißen Sommer als erstaunlich widerstandsfähig erwiesen, sagt Stiegeler. Gleichwohl will man die Prognosen des Ministeriums nicht auf die leichte Schulter nehmen. Im Rahmen der Erhebungen hätten die Stadtwerke ihre Hausaufgaben bereits gemacht, versichert Stiegeler. Das entsprechende Strukturgutachten zur Wasserversorgung Bad Säckingen liege dem Umweltministerium bereits vor.
Was muss die Stadt zur Sicherung der Trinkwasserversorgung tun?
Damit das Trinkwasser auch in den nächsten Jahrzehnten sprudelt, müssen Versorger grundsätzlich zwei Dinge im Blick haben: den Verbrauch und das Wasservorkommen. Beim Pro-Kopf-Verbrauch geht das Bad Säckinger Strukturgutachten bis 2030 nicht von einem Anstieg aus. Der liege seit 2015 bei etwa 154 Liter pro Kopf am Tag. Das werde sich die nächsten fünf Jahre nicht ändern, prophezeit das Gutachten.
Allerdings geht Stiegeler vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung in der Schweiz, namentlich im Sisslerfeld, in einigen Jahren von einer Bevölkerungszunahme in Bad Säckingen Richtung 19.000 Einwohner aus. Wenn durch die neu entstehenden Arbeitsplätze in der Region auch ein Bevölkerungsdruck für die Kurstadt entstehe, wird man wohl auch mit einem Anstieg der Gesamtverbrauchsmenge rechnen müssen.

Städtischer Wasserspeicher kann Hitze und Bevölkerungszuwachs verkraften
Die Bad Säckinger Trinkwasservorkommen könnten dies problemlos bewältigen, denn Stiegeler geht trotz Klimawandel nicht von einem sinkenden Grundwasserpegel aus. Die Wasservorkommen seien in den vergangenen, teilweise auch sehr heißen Jahren, selbst bei geringem Rheinpegel konstant geblieben, berichtet er.
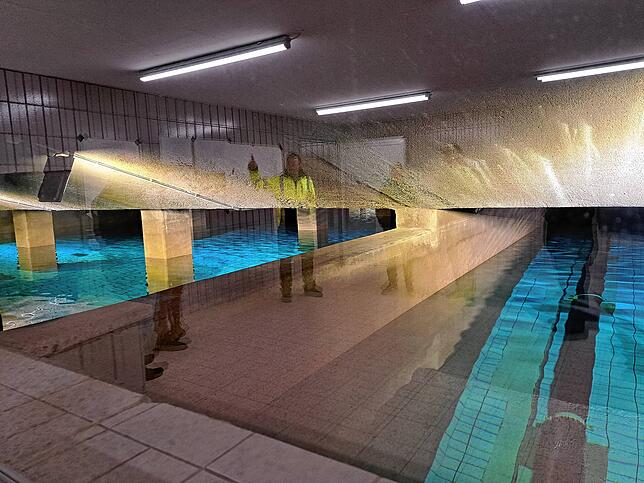
Zum Großteil werden die städtischen Brunnen aus dem Rhein gespeist, ein weiterer Teil fließe von der Hangseite des Hotzenwaldes in die Bad Säckinger Grundwasserspeicher, erklärt der Fachmann. Das Grundwasservorkommen befindet sich vor allem im Wasserschutzgebiet zwischen Obersäckingen und Murg.
Vorbeugende Maßnahmen
Eine der vorbeugenden Maßnahmen, die Fachleute zur Trinkwassersicherung vorschlagen, sind regionale Wasserverbünde. Auf diesen Weg hat sich der Hochrhein nach Stiegelers Worten bereits vor etlichen Jahren gemacht. Zur Nutzung der ehemaligen Soleleitung der Hüls AG zwischen Rheinfelden und Rheinheim als Notwasserversorgung habe sich der Wasserverbund Hochrhein (WVH) gegründet. Über die Leistung unterstützen die Stadtwerke Bad Säckingen konstant die Wasserversorgung der Nachbargemeinde Murg, da deren eigene Versorgung nicht ganz ausreiche.
Die jährlichen Verkaufsmengen an Murg schwanken laut Erhebung der Stadtwerke zwischen 40.000 und 80.000 Kubikmeter. In starken Trockenzeiten hat Bad Säckingen auch schon mal die Wasserversorgung der Nachbargemeinde Wehr unterstützen müssen. Mithin schätzt Stiegeler den WVH als wichtigen Baustein in der regionalen Wasserversorgung ein.
Aktuell werde im WHV darüber gesprochen, die alte Soleleitung entlang des Hochrhein zu erneuern – dies gerade vor dem Hintergrund der geplanten Wasserstoffleitung entlang des Hochrheins. Nicht geplant seien hingegen derzeit Maßnahmen wie der Bau von Regenrückhaltebecken, die notfalls zur Trinkwasserversorgung herangezogen werden könnten. Das hält Stiegeler nach Lage der Dinge für Bad Säckinger auch für die nächsten Jahre nicht für notwendig.
Zwischen 10 und 15 Prozent Wasserverlust
Allerdings seien natürlich ständig Investitionen in die Netzsicherheit vonnöten, erklärt der Ingenieur. Die Netzpflege, die stetige Überwachung und gegebenenfalls Erneuerung der Rohrleitungen seien wichtig für die Versorgungssicherheit. Die Wasserverluste des städtischen Netzes beziffert Stiegeler auf 10 bis 15 Prozent. Eingerechnet seien hier jedoch auch reguläre Wasserentnahmen, etwa über Hydranten bei Feuerwehreinsätzen.







