„Ich habe Mühe gehabt, mich zu freuen, wenn meine Tochter mir ein selbst gemaltes Bild geschenkt hat“, erzählt Andreas T. (Name von der Redaktion geändert) offen über seine Depression und die Auswirkungen, die die Krankheit für ihn mit sich bringt. „Man stumpft ab, wird gefühlsblind, zieht sich zurück“, zählt der Mann, der Ende 30 ist und im Landkreis Waldshut lebt, einige Symptome auf. Im Frühjahr 2016 erhielt er die Diagnose, dass er an einer schweren Depression erkrankt ist. Auch Suizidgedanken hatte er.
Dreieinhalb Jahre später hat sich Andreas T. entschieden, öffentlich über die Krankheit zu sprechen. „Weil ich mir wünsche, dass Betroffene aus dem Bericht Mut schöpfen und merken, sie sind nicht allein“, sagt er. Sein richtiger Name lautet anders. „Mein Chef und meine Kollegen wissen von meiner Depression“, sagt Andreas T. Dennoch möchte der Projektleiter anonym bleiben, weil er befürchtet, dass Kunden ihn aufgrund seine Erkrankung für weniger leistungsfähig halten.
Auslöser der Depression war ein schwerer Motorradunfall
Andreas T. leidet an einer sogenannten reaktiven Depression. Dabei handelt es sich um eine Reaktion auf besondere Lebensumstände. „Bei mir war der Auslöser ein schwerer Motorradunfall, bei dem ich lebensgefährlich verletzt wurde“, erzählt er. Ein Dreivierteljahr verbrachte er 2015 im Krankenhaus. Als die körperlichen Verletzungen verheilt waren, kehrte er in den Alltag zurück.
Doch Andreas T. bemerkte schnell, dass der Unfall weitere Spuren hinterlassen hatte. Um diesen aufzuarbeiten, suchte er eine Psychotherapeutin auf. „Sie hat mir gesagt, dass mein innerer Kompass auf die Zeit vor dem Unfall ausgerichtet war“, erinnert er sich an das Gespräch.
Rückblickend sagt Andreas T., dass er in dieser Zeit „neben der Spur“ war. Bei der Arbeit habe er sich „total überfordert“ gefühlt. „Ich hatte Zwölf- statt Acht-Stunden-Tage und habe trotzdem nicht das gleiche Pensum geschafft wie vor dem Unfall„, erzählt er. Manchmal sei er nachts um 3 Uhr ins Büro, weil er nicht schlafen konnte, und habe bis 22 Uhr am folgenden Abend durchgearbeitet.
„Alles ist zu viel. Man will nur noch weg“, beschreibt Andreas T., wie er sich damals fühlte.
„Man baut sich nach und nach eine Fassade auf. Man grinst, wenn andere lachen, obwohl einem nicht danach zumute ist. Man funktioniert so, wie die Gesellschaft es von einem erwartet.“
Andreas T.
Vor dem Unfall sei er ein extrovertierter Mensch gewesen, sagt er. Doch danach habe er sich immer mehr von seinen Mitmenschen zurückgezogen, sogar von seinen nächsten Angehörigen. Sein Verhalten bleibt von der Familie nicht unbemerkt. „Meine Frau sagte zu mir: Du schaust immer so böse und benimmst dich komisch“, erzählt er. Er habe dies auf den Stress geschoben.
„Bevor ich in die Klinik kam, konnte ich für mich sinnhaft erklären, dass ich sogar Schuld daran habe, dass es regnet.“
Andreas T.
Doch seine Frau ließ sich nicht mit Ausreden abspeisen. „Meine Frau kennt in ihrem Umfeld ein paar Fälle von Depressionskranken und wusste, worauf sie achten musste. Das war ein Stück weit mein Glück“, sagt er. Ein sogenannter Depressionsfragebogen, den er bei seiner Therapeutin ausfüllte, bestätigte die Vermutung der Therapeutin und der Ehefrau. Die Diagnose lautete: schwere depressive Episode, die in seinem Fall stationär behandelt wurde.
„Meine erste Reaktion lautete: Jetzt bin ich amtlich verrückt und komme ich in die Klapse.“
Andreas T.
Unmittelbar darauf folgte jedoch eine weitere Reaktion: „Jetzt kann mir geholfen werden“, erinnert er sich.
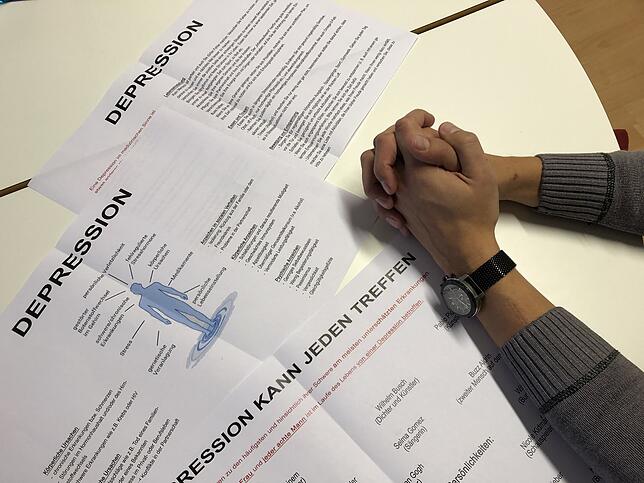
Sechs Wochen verbrachte er in einer Fachklinik. „Dort habe ich gelernt, was es heißt, depressiv zu sein und was das für mein Umfeld bedeutet.“
Andreas T. hat erkannt, dass die Partner mindestens genauso unter der Erkrankung leiden, wie der Betroffene selbst. „Leider fehlt ganz oft den Partnern das Verständnis, was oft zum Scheitern der Beziehung führt“, erzählt er.
Andreas T.s Frau gibt ihm großen Halt. „Sie wusste, dass es nicht vorbei ist, und ich nicht geheilt bin, als ich aus der Klinik kam“, fährt er fort. Seine Frau habe ihm schließlich den Flyer einer Selbsthilfegruppe für Menschen mit Depressionen in die Hand gedrückt. Sechs Wochen habe er überlegt, bis er per E-Mail Kontakt zur Gruppe aufnahm.
Halt in der Selbsthilfegruppe
Gegründet wurde die Selbsthilfegruppe im Februar 2018 von Daniel Boch und Joachim Gampp. „Wir sind keine Therapeuten. Betroffene, die unsere Gruppe besuchen möchten, müssen zuerst eine Therapie machen“, erklärt Daniel Boch, der mit Joachim Gampp Andreas T. zum Gespräch mit der Autorin begleitet.
Boch und Gampp sind selbst von der Krankheit betroffen. „Erst die Gruppentherapie in der Reha hat mir den Weg gezeigt“, erzählt Joachim Gampp, der vor acht Jahren die Diagnose Depression erhielt. Und Daniel Boch fügt hinzu: „Es bringt einem viel, wenn man erkennt, das man nicht allein ist.“
Zehn Mitglieder der Selbsthilfegruppe treffen sich zwei Mal pro Monat in St. Blasien. „Wir sind am Limit“, sagt Gampp. „Wir haben eine Warteliste mit sieben bis acht Leuten“, fügt Boch hinzu.
Andreas T. ist froh, sich mit anderen Betroffenen austauschen zu können.
„Bevor ich vor eineinhalb Jahren zur Gruppe kam, dachte ich, dass ich der einzige auf der Welt mit diesem Problem bin.“
Andreas T.
Gleichwohl sieht er sich nicht als geheilt an. „Ich stelle mich darauf ein, dass ich die nächsten Jahre Hilfe brauche“, sagt er und hofft, dass die Zeitabstände zwischen den depressiven Phasen größer werden. „Ich denke, dass die Krankheit mich mein Leben lang beschäftigen wird“, sagt Joachim Gampp.
Eine Krankheit wie jede andere auch
Dennoch zeigen die Beispiele, dass Betroffenen geholfen werden kann. „Der Mut für den ersten Schritt ist das Wichtigste, und genau da muss unsere Gesellschaft umdenken“, so die einhellige Meinung der drei Männer. Depression könne jeden treffen – vom Arbeitssuchenden, Schüler bis zum Spitzensportler, wie das Beispiel des deutschen Fußballtorwarts Robert Enke zeigt, der sich vor zehn Jahren das Leben nahm.
Hintergrund zur Krankheit und zu Betroffenen
„Ein Mensch, der mitten im Leben steht und keinen Ausweg mehr sieht, wird nur zu gerne in eine Schublade gesteckt. Wir möchten Mut machen, über Depression zu sprechen wie über jede andere Krankheit auch. Es gibt Hilfe, auch wenn es oft sehr schwer ist – wir sind nicht alleine“, sagen die drei Betroffenen.









