Tat einer früher den Mund auf, wusste man in den meisten Fällen nach den ersten Sätzen genau, wo er daheim war. Noch vor 100 Jahren hatte jeder Ort seine eigene Sprache. So strich man sich in Bonndorf zum Frühstück „Mus“ aufs Brot, in Säckingen „Eingmachtes“. Auf dem Höchenschwander Berg mähten Bauern eine „Matte“, auf der anderen Seite der Schwarza in Brenden war es eine „Wiese“. Die Kiesenbacher trugen ihr Brennholz im „Schiner“ aus dem Schopf, die Oberlauchringer verwendeten dafür eine „Zeine“. In Herrischried „schwanzte“ die Kuh beim Melken, in Grafenhausen „wadelte“ sie.
Die Welt ist eine andere geworden – und damit auch die Sprache
Früher waren all diese Worte Teil der lokalen Alltagssprache. Heute sind sie kaum noch zu hören. Zum einen natürlich, weil die Lebenswirklichkeit heute eine ganz andere ist, und nur noch wenige in jener bäuerlich geprägten Welt leben, von der diese alten Worte zeugen. Doch nicht nur die Welt, auch die Sprache hat sich im Südschwarzwald und am Hochrhein gewandelt.
Heute verwenden auch hier insbesondere jüngere Menschen im Alltag kaum noch Dialekt. Alemannisch ist an der Arbeitsstelle und auf dem Schulhof, im Verein und sogar in der Familie seltener zu hören als eine oder zwei Generationen zuvor. Wird die Heimat sprachlos?
Bei Hannes Probst gibt es Steuerberatung auf Alemannisch
Hannes Probst will, dass der Dialekt weiter zu hören ist. Der 47-jährige Niederhöfer betreibt in Bad Säckingen eine Steuerberatungskanzlei. Auf der Homepage bietet sie ihre Dienste auf Hochdeutsch und auf Alemannisch an. Kunden können dort um ein „usführliches Erstgspröch“ nachfragen, eine „automatische Erinnrig“ an „Stüertermine“ erhalten oder „aktuelli Muschtervorlage un Formular“ anfordern.

Für Probst ist dies mehr als nur ein Werbegag. „Ich bin mit der alemannischen Sprache groß geworden und halte sie für ein Kulturgut.“ Viele seiner meist aus der Region stammenden Kunden schätzten die Möglichkeit durchaus, Beratungsgespräche im heimischen Idiom zu führen, berichtet Probst.
In der Jugend wollten sie ihm den Dialekt austreiben
So viel Wertschätzung wurde dem Alemannischen nicht immer entgegengebracht, weiß der Steuerfachmann. Ihm selbst beispielsweise habe man in Kindheit und Jugend den Dialekt austreiben wollen, er – als vermeintliche Voraussetzung für den sozialen Aufstieg, erzähl er.
Für Manfred Markus Jung ist das Alemannische eine Kultursprache
Einer, der fuchsteufelswild wird, wenn er solche Geschichten hört, ist Manfred Markus Jung. Der 69-jährige Mundart-Dichter aus dem Wiesental betont immer wieder, dass Dialekte keine beschränkte unterschichtsspezifische Sprache seien, so wie dies in den 1960er und 70er Jahren manche Sprach- und Erziehungswissenschaftler behaupteten. Vielmehr gehöre das Alemannische spätestens seit 1803 mit dem Erscheinen von Johann Peter Hebels „Alemannischen Gedichten“ zur Weltliteratur. Es sei eine „unselige Erziehungsperiode“ gewesen, als Lehrer an den Schulen versucht hätten, den Kindern die „Bauernsprache“ auszutreiben, so Jung.

Er selbst hat mehr als 30 Jahre lang am Theodor-Heuß-Gymnasium in Schopfheim unter anderem Deutsch und Sport unterrichtet. „Unterrichtssprache war im Deutschunterricht natürlich Hochdeutsch, in anderen Fächern wie Sport aber Alemannisch“, sagt Jung. Er hält das aktive Beherrschen und den Gebrauch eines Dialekts für keinen Nachteil auf dem späteren Lebensweg, sondern im Gegenteil für einen Vorteil.
Wer Hochsprache und Dialekt spricht, tut sich mit dem Erlernen von Sprachen leichter
Inzwischen ist die Wissenschaft tatsächlich zur Auffassung gekommen, dass sich später leichter mit dem Erlernen von Fremdsprachen tut, wer als Kind schon erfahren hat, dass es Kartoffeln gibt und Herdöpfel, dass man je nach Umfeld die Sinnesaufnahme mit dem Ohr als hören oder lose bezeichnen kann, dass der Fuess mehr umfasst als der Fuß.
Dialekt in der Region
Nachdem der Dialekt Jahrzehnte lang aus der Schule herausgehalten wurde, gibt es seit 2003 Versuche, ihn dort wieder stärker zu verankern. Jung begrüßt deshalb Projekte wie „Mundart in der Schule“. Die alemannische Muettersproch-Gsellschaft, der schwäbische mund.art e.V. und der Förderverein Schwäbischer Dialekt haben einen Arbeitskreis gebildet, der Mundartkünstler in Schulen einlädt, um dort eine Doppelstunde zum Thema Dialekt zu gestalten.

„Vor sieben Jahren hatten wir etwa 30 Anfragen von Schulen in ganz Baden-Württemberg. Dieses Jahr ist bei mir bereits die 99. Anfrage eingegangen“, freut sich Heidi Zöllner. Die 74-jährige Mundartdichterin aus Hausen im Wiesental koordiniert landesweit das Projekt Mundart in der Schule und stellt für dieses Angebot eine steigende Nachfrage fest.
Heidi Zöllner setzt sich dafür ein, dass im Kindergarten Dialekt gesprochen wird
Zöllner selbst gestaltete beispielsweise an der Grundschule Öflingen dieses Jahr insgesamt acht Unterrichtsstunden zum Thema. Ihrer Meinung nach muss man aber viel früher damit beginnen, Kinder zum Gebrauch des Dialekts zu ermutigen. Für sie ist hier die Schweiz ein Vorbild, wo in vielen Kantonen die Mundart schon in den Bildungsplänen für die Kindergärten einen festen Platz hat. „Wir von der Initiative Mundart in der Schule sind deshalb im Augenblick dabei, Kindergärten auf unser Angebot anzusprechen.“
Landrat Kistler: Der Dialekt-Chef im Land
Für den Erhalt des Dialekts setzt sich auch der Landrat des Landkreises Waldshut, Martin Kistler, ein. Er wurde 2023 sogar zum Vorsitzenden eines Dachverbands gewählt, der die Dialekte in Baden-Württemberg schützen will. Das Land fördert den Verband mit 78.000 Euro im Jahr.
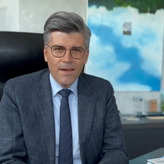
Der Dachverband der Dialekte in Baden-Württemberg (DDDBW) wurde auf Initiative von vier Landtagsabgeordneten aus vier Landtags-Fraktionen am 19. Juli 2023 in Stuttgart gegründet. Für Kistler ist der Dialekt mehr als nur eine Art sich auszudrücken. „Der alemannische Dialekt bedeutet für mich Heimat“, sagte der Landrat im vergangenen Jahr.
Dialekt verändert sich
Ganz sicher ist, dass sich das Alemannische wandelt – so wie das Deutsche auch. „Der Dialekt hat sich verändert, er hat sich abgeflacht, es gibt keine dörflichen Ortsdialekte mehr“, sagt Manfred Markus Jung. „Es mag sogar sein, dass der Dialekt verloren geht. Aber ich erlebe das ganz sicher nicht mehr.“
Und wie klingt der Dialekt bei uns?
So hört sich Alemannisch in Laufenburg, Jestetten, Klettgau und Eggingen an:







