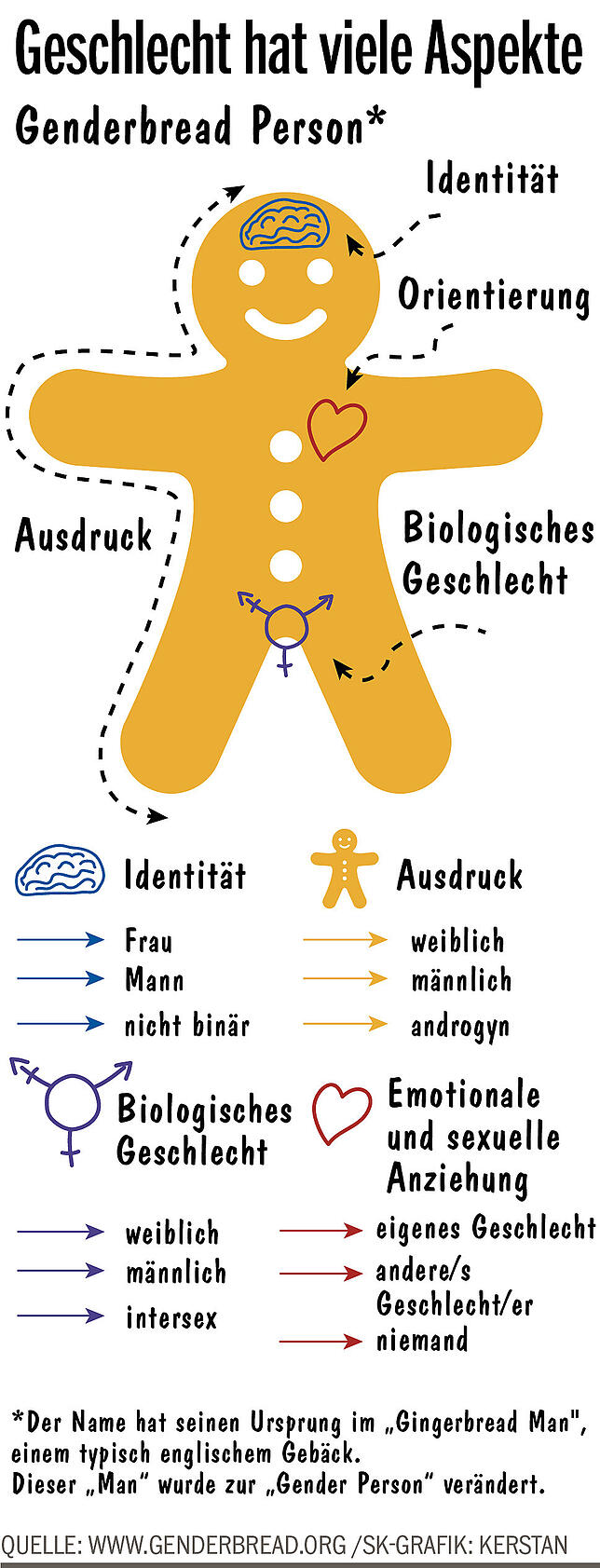Frauen und Männer, weiblich und männlich, w und m, Team rosa und Team blau, er und sie und ihm und ihr: Die Gesellschaft, in der wir leben, ist binär. Es gibt zwei Geschlechter. Es ist ein ganz wesentliches Kriterium in unserer Kultur, die Welt und unsere sozialen Kontakte einzuordnen: Ist das nun ein Mann oder eine Frau? Zwei Kategorien, die uns einen ersten Hinweis geben, mit wem wir es zu tun haben, wie diese Person tickt – oder vermeintlich ticken muss. Denn bei der Zuordnung zu Mann und Frau handelt es sich um Kategorien der Einteilung, die bei uns gelten, in anderen Kulturen aber anders aussehen können. Ist das Geschlecht nicht klar, werden wohl die meisten Menschen hierzulande schnell unsicher.
Menschen, die sich weder der einen, noch der anderen Kategorie zugehörig fühlen, gab es schon immer. Doch seit Januar 2019 gibt es nun sichtbare Hinweise, dass neben Frau und Mann noch etwas anderes existiert. „m/w/d“ ist laut Gesetz immer zu lesen, wenn es beispielsweise um Stellenausschreibungen geht. „d“ steht für „divers“ und schließt alle Menschen mit ein, auch solche, die sich selbst aufgrund körperlicher Gegebenheiten oder ihrem sozialen Empfinden nach nicht Mann oder Frau sind. Aber was sind das für Menschen? Wie denken und leben sie? Wir haben mit einer Person gesprochen, die von sich selbst sagt: „Ich bin nicht-binär und ich kämpfe um den Geschlechtsstatus ‚divers‘.“
Wallis Geschichte
Blaue lange Haare, Jeans, Sneaker, Pulli und Rucksack, ein freundliches Lächeln: Außergewöhnlich wirkt Walli im Café der Unibibliothek Freiburg keineswegs. Die meisten Studierenden hier sind praktisch gekleidet, und – vielleicht von der Haarfarbe und dem Piercing einmal abgesehen – stilisiert sich Walli nicht zum Hingucker.
Die unterbewusste Zuordnung von Walli in eine der beiden Geschlechterkategorien – wahrscheinlich aufgrund von Körpergröße und -formen, der Stimmlage im vorhergehenden Telefongespräch – erfolgt noch vor der Begrüßung: Aha, eine junge Frau. Walli sagt: „Ja, ich werde oft weiblich gelesen.“ Doch diese Zuordnung ist Wallis eigenem Empfinden nach falsch. Seit mittlerweile zehn Jahren ist Walli klar: „Ich passe einfach nicht in die beiden als gesellschaftlich vorgegebene Norm definierten Geschlechterkategorien männlich und weiblich.“
Walli wächst in einer ländlichen Region auf. Noch heute sind die Kontakte dorthin gut, werden Freundschaften gepflegt und das ganz unabhängig von der „offiziellen“ Geschlechtszuschreibung. Wie die Familie darauf reagiert, dass das Kind, das als Tochter aufwuchs, nicht als Frau lebt? „Dass ich nicht weiblich bin, war für meine Eltern schwer zu akzeptieren. Ich kann mir vorstellen, dass sie es meist einfach ausblenden“, sagt Walli. „Besonders schwer für sie zu akzeptieren war, dass ich meinen Namen geändert habe. An einem Namen hängen einfach sehr viele Vorstellungen, auch für das spätere Leben des Kindes, dran.“
Die Erkenntnis des Nicht-Binär-Seins kam für Walli bereits früh: „Ich konnte mich bereits nicht mit den geschlechtlichen Bildern identifizieren. Walli als Namen nutze ich seit etwa acht Jahren, also seit ich 14 bin.“ Doch das Konzept von mehr als zwei Geschlechtern lernte Walli erst vor drei oder vier Jahren kennen. „Öffentlich geoutet habe ich mich dann Stück für Stück innerhalb der letzten Jahre. Mein inneres bewusstes Outing, also die Erkenntnis, kam auch erst vor wenigen Jahren. Seither verfolge ich den Weg, der für mich richtig ist und setze mich aktiv dafür ein.“ Mitarbeit in verschiedenen Gruppen, auch politische Aktivität gehört dazu. Sehr erwachsen, überlegt und reflektiert wirkt Walli im Gespräch. Eigentlich deutlich reifer als 22. „Ich beschäftige mich sehr intensiv mit dem Thema“, lautet die Erklärung. Und der Nachsatz: „Dass es sich nicht um eine Phase handelt, ist auch meinen Eltern mittlerweile klar.“
Wie lebt und wen liebt Walli?
Was die Wahl von Partner*innen angeht: „Ich habe schon gewisse Vorlieben bei maskulinen, femininen und androgynen Menschen. Aber im Prinzip ist mir das Geschlecht meiner Beziehung egal.“ Als pansexuell kann benannt werden, wie Walli liebt. Pan bezeichnet die Liebe zu Menschen jeden Geschlechts, ausdrücklich auch von Inter*- und Trans*personen.
„Ich liebe nicht Männer oder Frauen, sondern Menschen“Walli liebt pansexuell
Seit Anfang des Jahres wohnt Walli in Freiburg mit Alexandra und Léon zusammen, die Liebesbeziehung mit beiden besteht schon länger. „Man kann unser Gefüge als Kette bezeichnen. Ich bin das Bindeglied, wobei Alexandra und Léon die äußeren Ränder bilden. Beide sind miteinander befreundet, führen aber keine Liebesbeziehung. Alex hat außerdem noch eine weitere Beziehung.“ Im Gegensatz zu Walli und der ebenfalls nicht-binären Alex hat Léon keine Schwierigkeiten, sich als Mann zu bezeichnen. „Aber das ist komplett irrelevant, denn letztendlich geht es immer um die Beziehung zum jeweiligen Menschen.“
Der Kampf um die Anerkennung als „divers“
Den Vornamen hat Walli bereits gewechselt und bei manchen Einrichtungen sei die geschlechtsneutrale Erfassung völlig problemlos möglich, so beispielsweise bei der Bank oder bei Versicherungen. Auch Wallis Uni-Card kommt ohne Zuordnung zum binären Konsens aus. Möglich wurde dies durch den Ergänzungsausweis der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität (dgti), der online beantragt werden kann. Wallis letzter Schritt, die offizielle Umschreibung des Geschlechts beim Standesamt, steht allerdings noch aus.
Insbesondere die Attest-Pflicht mache es Walli nach eigenen Angaben schwer. Und daran hat auch ein erneutes Urteil des Bundesgerichtshofs im Mai 2020 nichts geändert. Wer sein Geschlecht beim Standesamt offiziell ändern lassen möchte, braucht ein ärztliches Attest über die „Variante der Geschlechtsentwicklung“. In Wallis Fall ein echtes Problem: „Ich kämpfe seit über einem Jahr darum, ein solches Attest zu bekommen. Doch es ist schwierig, weil viele Ärzt*innen das einfach nicht ausstellen wollen.“ Hier bestehe eine große Unsicherheit, so Wallis Erfahrung.
Woher diese Unsicherheiten kommen? Auf unsere Nachfrage teilt Mark Berger von der Bundesärztekammer mit: „Spezifische Risiken beim Ausstellen dieser Atteste bestehen aus unserer Sicht nicht.“ Allerdings: „Es gelten hier die allgemeinen Grundsätze, dass Ärzte Atteste nur über Gegenstände ausstellen dürfen, die sie beurteilen können, und dass Atteste inhaltlich zutreffen müssen.“ Wallis Problem: „Ich bin biologisch weiblich, mein soziales Geschlecht ist aber als nicht-binär einzuordnen. Wie alles Mentale, kann ich mein soziales Geschlecht nicht beweisen. Crazy ist einfach, dass es dabei um einen kleinen Zettel mit einem Satz geht, der für niemanden auf der Welt irgendwas schlecht macht, aber mir und vielen anderen viel Leid ersparen würde.“ Über die Zahl der ausgestellten Atteste über eine „Variante der Geschlechtsentwicklung“ könnten laut Mark Berger weder Bundes- noch Landesärztekammern Aussagen treffen.
Geschlechtszuschreibung nach rein biologischen Kriterien
Erfülle man den „körperlichen Mangel“ nicht, gelte es, sich immer wieder zu erklären und zu rechtfertigen, so Walli. Denn um eine Eintragung ‚divers‘ zu erreichen, hatte der Bundesgerichtshof erst im Mai 2020 alle Menschen ohne einen entsprechenden ärztlichen Nachweis auf die wesentlich umfangreicheren Vorgaben nach dem Transsexuellen-Gesetz (TSG) verwiesen, die unter anderem die Einholung von zwei umfangreichen Sachverständigengutachten sowie eine gerichtliche Anhörung umfassen.
Walli sagt dazu: „Der Weg über das TSG kann schrecklich anstrengend, nervenaufreibend, zeitaufwändig, bloßstellend und kompliziert sein. Außerdem verfügen nicht alle Menschen über die Ressourcen, sich diesem zeitlichen, finanziellen und bürokratischen Aufwand zu unterwerfen. Da geht es noch nicht mal um den Wunsch nach körperlichen Veränderungen, sondern rein um Namen und Geschlechtseintrag. Divers geht nur über das Attest, was eben sehr wenige ausstellen wollen. Das ist mit Sicherheit einer der Gründe, warum bislang noch nicht so viele Änderungen des Geschlechtseintrags vorliegen.“
Nach Recherchen der Wochenzeitung „Die Zeit“ lagen im Mai 2019 deutschlandweit erst rund 150 Anträge auf die Änderung des Geschlechtseintrags „divers“ bei den Standesämtern vor. In der Bevölkerungsstatistik wird divers bereits geführt, allerdings sei die statistische Darstellbarkeit noch ungeklärt. „Insgesamt können wir Ihnen derzeit leider (noch) keine belastbare Anzahl an Personen mit Geschlecht ‚divers‘ nennen“, teilt das Statistische Landesamt Baden-Württemberg auf Nachfrage mit.
Geschlechtsneutral im Alltag
Abseits der Frage, wie viele Menschen als divers anerkannt sind: Wie gelingt es, sich im Alltag von binären Geschlechtszuschreibungen zu lösen? Hier sieht Walli, aber auch Organisationen wie der Bundesverband Trans* vor allem die Sprache als wichtiges Instrument. Beispielsweise durch inklusive Anreden, die auf „Herr“ und „Frau“ verzichten, erklärt Walli: „Guten Tag in Kombination mit Vor- und Nachname sind eine gute Möglichkeit, ebenso wie das Gendersternchen ‚Liebe*r Walli‚ zum Beispiel.“ Ebenso seien die Personalpronomen „er“ und „sie“ bei offiziellen Anschreiben kritisch zu sehen. Walli schränkt hier aber selbst ein: „Die Pronomen sind für mich persönlich im privaten Umfeld ein Bonus. Ich muss einfach schauen, in welchen Bereichen es sich für mich lohnt, dafür zu kämpfen.“
Für den neuen Arbeitgeber ihres Studentenjobs war Wallis Wunsch nach Geschlechterneutralität kein Problem: „Ich habe von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Ein kleiner Hinweis hat ausgereicht und es wurde darauf geachtet, dass die inklusive Schreibweise eingehalten wird.“
Was an dieser Stelle kein Problem ist, ist es allerdings in vielen anderen Bereichen. Eine Belastung für nicht-binäre Menschen wie Walli: „Ich wünsche mir endlich juristische Anerkennung, so dass ich meinen Namen und meinen Geschlechtseintrag offiziell ändern kann.“