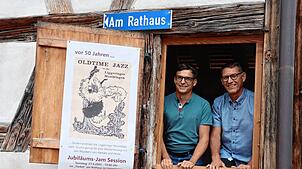Radolfzell Die Baugenossenschaft Familienheim Bodensee mit Sitz in Radolfzell konnte das Jahr 2024 mit einem guten Ergebnis abschließen. Dies war in der Hauptversammlung der Mitglieder in der Geschäftsstelle zu hören. In einem weiterhin schwierigen Arbeitsumfeld habe die Genossenschaft gegenüber 2023 einen Umsatz-Zuwachs von 8,3 Prozent auf 12,8 Millionen Euro erreicht, sagte der Vorstandsvorsitzende, Stefan Andelfinger. Es ermöglichte der Genossenschaft, einen Jahresüberschuss von mehr als 2,2 Millionen Euro zu erwirtschaften. Das entspricht einer Umsatz-Rendite von über 17,5 Prozent. Die Ergebnis-Rücklage konnte mit 2,18 Millionen Euro dotieren werden. Die Hauptversammlung stimmte dem Vorschlag des Vorstands zu, vom Bilanzgewinn eine Dividende von vier Prozent des Geschäftsguthabens in Höhe von rund 52.186 Euro an ihre Mitglieder auszuschütten.
Die Kostenseite der Baugenossenschaft blieb nahezu auf dem Vorjahresniveau, sagte Andelfinger. Darin spiegle sich die rege Bautätigkeit mit einer sich kontinuierlich erhöhenden Abschreibung wieder. Die betrieblichen und sonstigen Aufwendungen seien vor allem deshalb gestiegen, weil die Baugenossenschaft in allen Bereichen Preissteigerungen verzeichnete. Die Baugenossenschaft habe zudem viel in die Sicherheit ihrer Datenverarbeitung investiert und die Digitalisierung vorangetrieben. Die Zinsaufwendungen seien deshalb leicht gestiegen, weil die Genossenschaft die auslaufenden Kreditfinanzierungen heute teurer refinanzieren müsse. Erfreulich sei aber, dass die Baugenossenschaft ordentliche Zinseinnahmen auf der Haben-Seite verbuchen konnte, die ihre Zinsaufwendungen übertroffen haben.
Die Bilanzsumme bewegt sich nahezu unverändert bei 94,4 Millionen Euro. Diese werde aufgrund der anhaltenden Bautätigkeiten in den kommenden Jahren weiter anwachsen. „Auch im Anlagevermögen schlummern noch erhebliche stille Reserven, was für die Genossenschaft im Gesamten sehr beruhigend ist“. Die genossenschaftliche Bilanz-Relation beschrieb Andelfinger „in einer ausgezeichneten Balance“. Sie sei „das Resultat einer langfristig und konsequent verfolgten Liquiditäts- und Ergebnissteuerung“. So konnte die Genossenschaft auch bei steigenden Zinsen immer handlungsfähig bleiben.
Die Baugenossenschaft Familienheim feiert ihr 75-jähriges Bestehen. In seiner Jubiläumsrede hob Andelfinger die wichtige Bedeutung von Baugenossenschaften hervor. Im 21. Jahrhundert treibe viele Menschen das Unbehagen um, dass ihnen die Städte nicht mehr gehören würden und dass das Wohnen zum Luxus geworden sei. Der Vorsitzende stellt in seiner Rede überaus wichtige Fragen: Wie wollen wir wohnen? Wie wollen wir zusammenleben? Und was ist unsere Stadt, unsere Gemeinde, unsere Gemeinschaft, Nachbarschaft und Zuhause wert?
Andelfinger näherte sich den Fragen aus verschiedenen Blickwinkeln: Die Geschichte der Baugenossenschaft sei eine der Selbsthilfe. Entstanden seien sie in Zeiten, in denen Menschen vom Wohnungsmarkt und vom Zugang zu Wohnraum systematisch ausgeschlossen worden waren, sei es durch Armut, Krieg, wirtschaftliche Umbrüche oder fehlenden staatlichen Schutz. Ende des 19. Jahrhunderts begannen sich Arbeiter, Handwerker und Angestellte zu organisieren. Der genossenschaftliche Gedanke war geboren: „Was einer allein nicht schafft, schaffen viele.“
Die Baugenossenschaften schafften gemeinsames Eigentum mit einer demokratischen Selbstverwaltung und sozialen Verantwortung. Andelfinger: „Nicht Spekulation steht im Vordergrund, sondern Versorgung. Nicht Gewinn, sondern Gemeinwohl. Nicht Fremdbestimmung, sondern Mitgestaltung.“ Im Gegensatz zu vielen privaten Wohnungsunternehmen wirtschaften die Genossenschaften nicht gewinnorientiert. Sie vermieten nach dem Kostendeckungsprinzip. Das bedeute für die Mieter stabile Mieten – auch in Boomphasen: Es gebe keine Spekulation mit Wohnraum und keine Angst vor Luxussanierungen und Eigenbedarfskündigungen. Die Mieter der Baugenossenschaft Familienheim genießen ein lebenslanges Wohnrecht.
Da jedes Mitglied, unabhängig von seinen Anteilen, nur eine Stimme habe, werde Demokratie gelebt, so Andelfinger: Die Mitglieder entscheiden über die Investitionen, Sanierungen und Modernisierungen. Und während vielerorts die Gentrifizierung ganze Quartiere verändern würde, bewahrten Baugenossenschaften oft über Jahrzehnte eine soziale Durchmischung. Denn die Mitglieder rekrutieren sich aus unterschiedlichen Berufen, Altersgruppen und kulturellen Hintergründen. Baugenossenschaften dächten in Jahrzehnten und nicht in Quartalszahlen.