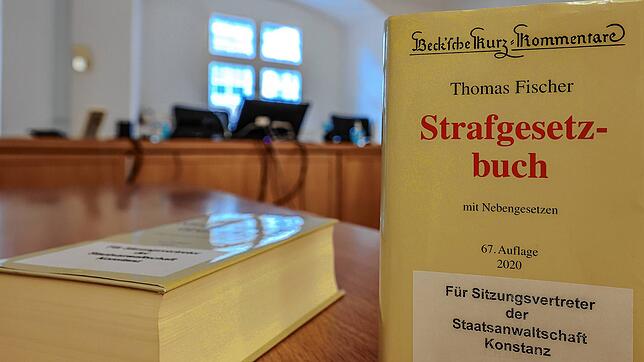Als im Frühjahr 2020 das Coronavirus Deutschland erreichte, standen plötzlich viele Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen durch die Pandemie-bedingten Einschränkungen kurz vor dem wirtschaftlichen Aus. Um die Existenz der Betroffenen zu sichern, wurden Subventionen – sogenannte Corona-Soforthilfen – ausgezahlt. Ein 70-Jähriger aus dem Schwarzwald musste sich nun wegen Subventionsbetrug vor dem Amtsgericht Radolfzell verantworten.
Der als Selbstständiger tätige Angeklagte hatte im Frühjahr 2020 Corona-Soforthilfe in Höhe von 9000 Euro beantragt und auch erhalten. Doch laut der Staatsanwaltschaft hatte der 70-Jährige eigentlich gar keinen Anspruch auf das Geld. Denn Unternehmen, die sich bereits vor dem 31. Dezember 2019 in finanziellen Schwierigkeiten befanden, waren von den Subventionen ausgeschlossen.
Falsche Angaben gemacht
Dem 70-Jährigen wurde vorgeworfen, bei der Beantragung der Corona-Soforthilfe falsche Angaben gemacht zu haben. „Der Angeklagte befand sich schon länger in wirtschaftlichen Schwierigkeiten“, sagte der Staatsanwalt bei der Eröffnung der Gerichtsverhandlung. Somit hätte der Angeklagte die Soforthilfe nicht erhalten dürfen.
Unter anderem hatte es bereits Jahre zuvor Pfändungsbeschlüsse und Vollstreckungsmaßnahmen gegen den Angeklagten aufgrund von Schulden beim Finanzamt sowie bei einer Krankenkasse gegeben. Diese räumte der Angeklagte, der laut eigener Aussage seit Jahren freiberuflich in der Automobilbranche arbeitet, in seiner Aussage auch ein. Allerdings sei er unverschuldet in die Situation geraten.
Plötzlich will das Finanzamt Geld
In seiner Tätigkeit als Freiberufler habe er bis Anfang 2012 unter anderem einen Automobilvertrieb in Nordrhein-Westfalen geleitet. Nach der Einstellung des Vertriebs und der Beendigung seiner Tätigkeit als freiberuflicher Betriebsleiter im Einvernehmen mit dem amerikanischen Geschäftsführer habe er einige Zeit später eine böse Überraschung erlebt: Das deutsche Finanzamt habe ihn nachträglich zum faktischen Geschäftsführer erklärt und Tausende Euro an Körperschaftssteuer eingefordert, die er nicht zahlen konnte. Er sei damals „aus allen Wolken gefallen“, erinnerte sich der 70-Jährige. Dadurch sei es zur Kontopfändung sowie zu Problemen bei der Zahlung von ausstehenden Sozialabgaben gekommen.
Das eigene Unternehmen des Angeklagten – für das er die Soforthilfe 2020 beantragt hatte – habe immer Überschüsse ausgewiesen, ergänzte der Verteidiger und widersprach damit den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft. „Das Unternehmen war seit 1985 nie in der Krise“, so der Verteidiger. „Das ist das einzig relevante.“ Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der eigenen Firma des Angeklagten bestanden nicht schon im Jahr 2019, sondern seien eine Folge der Corona-Krise.
Die Ausführungen der Verteidigung überzeugte die Richterin Ulrike Steiner jedoch wenig. Wenn das Unternehmen des Angeklagten so gut lief, wo ist dann das Geld, fragte die Richterin. „Unter der Matratze?“ Denn anhand der Kontoübersicht könne man guten Gewissens davon ausgehen, dass Zahlungsschwierigkeiten beim Angeklagten vorlagen, erklärte sie. So habe die damalige Lebensgefährtin ihm immer wieder kurz vor fälligen Zahlungen Geld überwiesen.
Zeugen bestätigen Geldflüsse
Dass der Angeklagte in finanziellen Schwierigkeiten steckt, diesen Eindruck hatte auch der damalige Ermittler der Polizei, wie er im Zeugenstand schilderte. Er bestätigte auch, dass es den Kontoauszügen zufolge immer wieder Geldflüsse zwischen der damaligen Lebensgefährtin und dem Angeklagten kurz vor fälligen Zahlungen gegeben hatte.
Die langjährige Lebensgefährtin des Beschuldigten, die ebenfalls als Zeugin aussagte, schilderte ihre Sicht der Dinge: „2019 dachte ich noch, dass alles absolut ok war“, berichtete sie auf Nachfrage der Richterin. Der Angeklagte habe ihr von Aufträgen erzählt, die gut angelaufen seien. Sie habe deshalb 2019 nicht den Eindruck gehabt, der Angeklagte habe Zahlungsschwierigkeiten.
Sie habe ihm zwar wiederholt Geld geliehen, es aber immer wieder zurückbekommen. Aber wie sich im weiteren Verlauf der Verhandlung herausstellte, hatte der Angeklagten ihr deutlich weniger Geld zurückgezahlt, als zuvor geliehen.
Staatsanwaltschaft sieht Vorwurf als erwiesen an
Der Staatsanwalt sah den vorsätzlichen Subventionsbetrug des Angeklagten als erwiesen an: Der 70-Jährige habe sich bereits 2019 in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befunden und somit keinen Anspruch auf die Corona-Soforthilfe gehabt. Diese Einschätzung begründete der Staatsanwalt unter anderem mit einer Kontopfändung sowie den noch ausstehenden Verbindlichkeiten in Höhe von mehreren Tausend Euro im Jahr 2019.
Des Weiteren hätten sich Ende Dezember 2019 lediglich 1,55 Euro auf dem Konto des Angeklagten befunden. Damit habe die Liquiditätslücke weit über dem Grenzwert von minus 10 Prozent gelegen, womit eine Zahlungsunfähigkeit nachgewiesen sei, so der Staatsanwalt. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 40 Euro.
Verteidiger kann Richterin nicht überzeugen
Die Verteidigung sah hingegen keinen Anhaltspunkt für ein Fehlverhalten des Angeklagten bei der Antragsstellung. Der Angeklagte habe außerdem keinen Euro aus den Soforthilfen für das Begleichen von Altlasten verwendet, erklärte der Verteidiger. Zudem seien inzwischen alle offenen Verbindlichkeiten beglichen worden.
Doch die Verteidigung konnte die Richterin Ulrike Steiner damit nicht überzeugen. Sie schloss sich bei ihrem Urteil den Argumenten der Staatsanwaltschaft an. Für den Angeklagten spreche jedoch, dass er keine Vorstrafen habe und die Antragsstellung durchaus komplex gewesen sei. Schlussendlich verurteilte das Gericht den Angeklagten zu 60 Tagessätzen a 40 Euro, also einer Geldstrafe von insgesamt 2400 Euro.