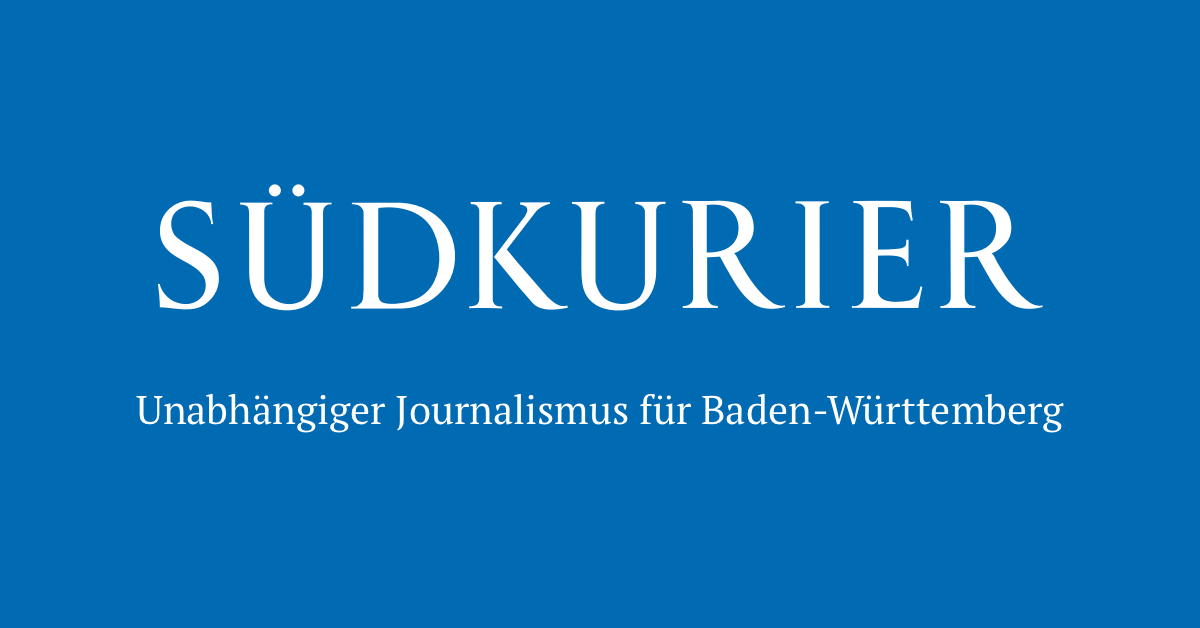Wenn Melek die Bilder sieht, die sie derzeit aus der Ukraine erreichen, muss sie an ihre eigene Geschichte denken. Sie sagt, sie könne verstehen, was die Menschen fühlen und denken – weil sie es selbst erlebt habe.
Leben in Furcht
Melek trägt in Wirklichkeit einen anderen Namen. Sie will anonym bleiben, denn gegen sie liege in der Türkei ein Haftbefehl vor, sagt sie. Dort habe sie sich für die Rechte der kurdischen Bevölkerung eingesetzt – sie selbst sei Kurdin. Özge Poyraz, Verwaltungsmitarbeiterin und Dolmetscherin dieses Gesprächs, geht davon aus, dass Melek sich nun auch vor der Organisation fürchten muss, der sie einst angehörte.

Die 29-jährige Kurdin ist schwer traumatisiert. Seit zwei Monaten wird sie in der Donaueschinger Klinik am Vogelsang stationär behandelt. „Die Bilder aus der Ukraine, die ich sehe, nehmen mich mit – trotz der positiven Entwicklung durch meine Therapie. Mit ein paar Sitzungen gehen manche Dinge nicht weg.“
Selbstschutz vor Nachrichten über Ukraine-Krieg
In ihrem Kopf kehre sie dann doch wieder in die Vergangenheit zurück. Nachrichten über den Krieg meide sie daher im Moment. „Ich mache das nur, um mich und meine Psyche zu schützen. Denn wenn ich das Trauma nicht überwinde, kann ich für mich und andere Menschen auch nichts tun.“
„Wenn die Menschen den Fernseher einschalten, sehen sie die Bilder von Bomben und Flugzeugen, die über die Städte fliegen, und erinnern sich an das, was sie genau so erlebt haben.“Jan Ilhan Kizilhan, Psychologe und Therapeut
Wie sich der Krieg in der Ukraine auf Traumatisierte in Deutschland auswirkt, beobachtet auch der Diplom-Psychologe Jan Ilhan Kizilhan. Er leitet in Donaueschingen die Abteilung Transkulturelle Psychosomatik, in der Melek behandelt wird. „Wenn die Menschen den Fernseher einschalten, sehen sie die Bilder von Bomben und Flugzeugen, die über die Städte fliegen, und erinnern sich an das, was sie genau so erlebt haben.“
Auslöser für Ängste
Diese Reize können laut Kizilhan Ängste auslösen und zurück in die eigenen Traumata führen – wenn die Betroffenen nicht stabil genug sind oder die Situation nicht einordnen können. „Das sehen wir auch in der Klinik. Wir haben Patienten, die aus dem Irak, Afghanistan, Irak kommen und uns das in der aktuellen Situation berichten.“
Bei vielen sei die Reaktivierung der Traumata – verbunden mit Symptomen wie Albträumen, Schlaf- und Konzentrationsstörungen – nur vorübergehend, vermutet Kizilhan. „Es wird prozentual aber bestimmt eine kleine Gruppe geben, die einen Rückschritt erlebt und erneut eine Behandlung braucht.“
Unkomplizierte Hilfe wichtig
Hier seien vor allem Sprechstunden verschiedener Traumazentren gefragt, in denen die Menschen schnell und unkompliziert Hilfe erhalten könnten. „Vielleicht sollte der Staat diese Angebote zumindest vorübergehend, vielleicht für ein Jahr, personell und finanziell aufstocken.“
Kizilhan beobachtet zugleich eine „unglaubliche Solidarität“ der Traumatisierten. „Sie wissen ja, was es bedeutet. Und ich finde es sehr eindrücklich, wenn gerade diese Traumatisierten auf die Straße gehen und für die Menschen in der Ukraine demonstrieren.“
Für die Betroffenen habe das einen positiven Nebeneffekt: Das aktive Einsetzen für andere Menschen, die traumatisiert sein könnten, führe zur Verarbeitung der eigenen Traumata und zu einer gewissen Stabilität.

Auch Melek drückt ihre Solidarität und Empathie mit den Menschen in der Ukraine aus. „Ich möchte nicht, dass das, was dem kurdischen Volk passiert ist, ein anderes Volk genauso erlebt.“ Die 29-Jährige beschäftigt aber noch etwas anderes: „Menschen aus der Ukraine können ganz leicht nach Deutschland flüchten und ihnen wird alles freigestellt.“ Das sei auch richtig so.
Ein Gefühl der Diskriminierung
Doch auch aus anderen Regionen der Welt müssten Menschen flüchten, hätten Menschen Angst, umgebracht zu werden – so wie sie selbst. Für diese Menschen sei es viel schwieriger, nach Deutschland zu kommen. „Warum ist das so? Weil wir schwarze Haare haben und sie nicht?“ Melek sagt, sie spüre diese Diskriminierung immer wieder, was zu zusätzlichem Stress führe, und auch anderen gehe es so.
„Warum kümmern sich die Deutschen jetzt stärker um die Ukrainer und warum ist es ihnen egal, was in Syrien, Afghanistan oder Afrika passiert? Das sind bestimmt Vorwürfe, die jetzt da sind“, sagt Psychologe Kizilhan.
Vielfältige Gründe für Solidarität mit Ukraine
Dabei müsse man aber die Gründe für die große Solidarität mit der Ukraine betrachten, die vielfältig seien – politisch, gesellschaftlich, historisch. Vor allem die unmittelbare Nähe des Konfliktes sei dabei entscheidend.
Riesige Hilfsbereitschaft für Jesidinnen
Außerdem bleibe abzuwarten, wie lange diese hohe Motivation letztlich anhalten werde. „Als wir damals die jesidischen Frauen nach Baden-Württemberg geholt haben, war die Hilfsbereitschaft ebenfalls riesig.“
Wodurch ihr Trauma ausgelöst wurde, möchte Melek im Einzelnen nicht sagen – das sei ihr zu privat. „Es war aber vor allem die Angst, durch die Polizei, durch die Regierung Folter zu erleben und im Gefängnis zu landen.“ Auch Kriegssituationen habe sie erlebt. Die Krankheit habe ihr dann die Freude und Energie am Leben genommen.
Seit ihrer Ankunft in Deutschland im Jahr 2017 habe sie die Sprache deshalb noch immer nicht lernen können. „Ich habe einfach nicht die Kraft dazu. Mein Kopf geht immer in die Vergangenheit zurück und bleibt dort hängen.“
Ein Attentat auf das Verstehen der Welt
Menschen mit einer schweren Traumatisierung könnten ihren Alltag in der Regel nicht bewältigen, bestätigt Kizilhan. Manche fielen in Ohnmacht, hätten Angststörungen oder Depressionen. „Das heißt, sie sind nicht mehr in der Lage, ihr früheres alltägliches Leben zu führen und bedürfen dringend psychotherapeutischer Hilfe.“ Eine Posttraumatische Belastungsstörung sei professionell gut behandelbar.
Kizilhan warnt jedoch davor, den Begriff der Traumatisierung inflationär zu gebrauchen. „Ich sage immer: Ein Trauma ist ein Attentat auf das Verstehen der Welt.“ Dabei könne das Gedächtnis Schockzustände erst einmal nicht verarbeiten. „Das ist aber noch kein klinisches Bild. Die Menschen werden also nicht automatisch klinisch krank“, betont der Experte.
Traumata wirken sich ganz unterschiedlich aus
Die Folgen hingen von den individuellen Verarbeitungsmechanismen und der jeweiligen Resilienz ab. Selbst in Kriegsgebieten könne rund die Hälfte der Betroffenen gut mit der Situation umgehen, je ein Viertel könne die Erlebnisse nach wenigen Monaten verarbeiten oder entwickle das klinische Krankheitsbild der Posttraumatischen Belastungsstörung.
Meleks Zeit in Donaueschingen ist bald vorbei. Sie fühle sich gut, sagt sie. Die Therapie habe sie stärker und selbstbewusster gemacht und sie wisse nun, wie sie mit ihren Problemen umgehen könne. Melek möchte jetzt endlich Deutsch lernen und eine Ausbildung beginnen – vielleicht im Bereich des Dolmetschens, aber sicher ist sie sich noch nicht.
Sie will selbst den Ukrainern helfen
Und sie möchte den Menschen aus der Ukraine helfen, vielleicht sogar Geflüchtete in ihrer Wohnung aufnehmen. Das sei selbstverständlich, „weil wir die gleiche Trauer, den gleichen Schmerz erlebt haben.“ Wichtig sei, so Melek, dass in schwierigen Zeiten die Menschheit zusammenstehe. „Religion, Sprache, Herkunft, Aussehen – das spielt keine Rolle.“