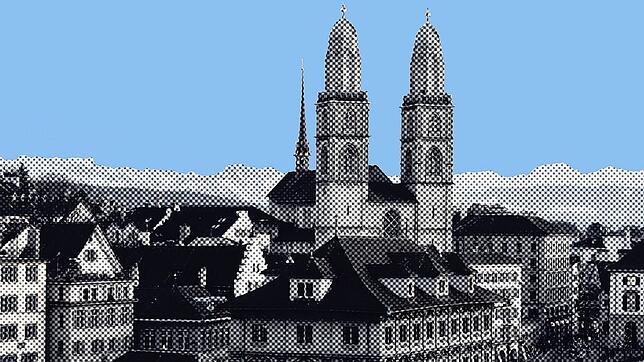„Ich hätte nie gedacht, dass ich so lange lebe“, sagt Mario* [*Name von der Reaktion geändert]. Mario ist 69 Jahre alt. Ohne Kokain zu rauchen, kommt er morgens nicht aus dem Bett. Erst nach drei, vier Zügen ist er wieder „ein normaler Mensch“. Und nach dem Aufstehen konsumiert er weiter – in Einrichtungen, die die Stadt Zürich geschaffen hat.
Knapp 70 Kilometer von Konstanz entfernt können Menschen wie Mario unter Aufsicht von medizinischem Personal Heroin fixen, Koks sniefen und Crack rauchen – ohne strafrechtliche Konsequenzen fürchten zu müssen. In den sogenannten Kontakt- und Anlaufstellen der Stadt Zürich.

Suchtkranke, aber auch Jugendliche, die kiffen oder Pillen auf Techno-Partys schmeißen, können ihre Substanzen zum Drogeninformationszentrum (DIZ) bringen und untersuchen lassen, ob etwas Gefährliches beigemischt wurde. Manchmal gehen die Mitarbeiter des DIZs auch direkt auf Partys und Festivals, um Substanzen zu prüfen. Sieht so die Drogenpolitik der Zukunft aus?
Soziale Arbeit und Polizei arbeiten Hand in Hand
Florian Meyer, 43, ist der Abteilungsleiter Schadensminderung Illegale Substanzen. Meyers Büro ist unweit vom Züricher Hauptbahnhof, über einer der Anlaufstellen. Etwa 900 Mal pro Tag konsumieren Menschen in diesen Einrichtungen illegale Drogen. „Das ist das, was hier stattfindet und nicht auf der Straße“, sagt Meyer.

Heroin, Kokain und Co. sind auch in der Schweiz verboten, der Konsum wird in den Anlaufstellen aber geduldet. Außerhalb nicht. Soziale Arbeit und Polizei arbeiten Hand in Hand, die einen ziehen die Konsumenten in die Einrichtungen, die anderen drängen.
Zwei Bahnstationen von Meyers Büro entfernt stehen neben den Gleisen ein umzäunter Flachbau aus Holz und ein weißer Containerwagen. Die Anlaufstelle Brunau ist eine von drei Einrichtungen, wo konsumiert werden kann – von 7.30 bis 21.30 Uhr ist immer eine Anlaufstelle geöffnet.

Die Luft im Inneren ist miefig, die Lüftung läuft nicht richtig. Ein paar Sessel stehen im Raum, ein großer Tisch, daneben flackert stumm ein Fernseher. Hinter einer Theke quatschen Mitarbeiter, auf Schildern steht: Ratatouille mit Linsen: 1 Franken. Frühstück (zwei Scheiben Brot, Butter, Konfi/Honig): 1,60 Franken.
Die Besucher dürfen sich den ganzen Tag hier aufhalten. Konsumieren. Pause machen. Konsumieren. Pause machen. Der Konsumraum ist mit einer Glaswand abgetrennt. Er erinnert an ein Café, nur stehen statt Kaffee und Kuchen Crackpfeifen auf den Alutischen. 18 Konsum-Plätze hat der Raum, die Besucher haben eine halbe Stunde Zeit zu konsumieren, dann müssen sie ihren Platz für andere räumen.
Konsumiert wird in einem weißen Containerwagen
Vor dem Raum steht Roland, dünn, kurze Hose, rotes T-Shirt, mit einem Klemmbrett in der Hand. Er arbeitet als Betreuer in der Anlaufstelle, gerade macht er den Türsteher. Roland sagt an, wer als nächstes rein darf und wer raus muss.
Vielen Besuchern sieht man den jahrelangen Konsum an. Sie taumeln leicht, schlurfen über den Boden und sprechen undeutlich. Ein Mann mit weißer, gefleckter Malerhose umarmt Roland, darf rein. Er setzt sich, nimmt einen Zug aus seinem Pfeifchen und unterhält sich mit einem anderen Besucher.
Gedrückt, also mit einer Spritze intravenös konsumiert, wird in dem weißen Containerwagen neben dem Holzbau. Nur ein Absperrband schirmt den Weg zum Containerwagen von der Straße ab. Im Inneren des Wagens ist es stickig, zwei Mitarbeiterinnen geben Spritzen aus und passen auf, dass es den Besuchern gut geht.
Vor dem Eingang der Anlaufstelle sitzt ein Mitarbeiter in dunkelblauer Uniform und kontrolliert die Besucher. Nur Menschen, die in Zürich gemeldet sind, konsumieren und über 18 Jahre alt sind, dürfen die Anlaufstellen betreten. Neben dem Eingang blitzen müde Augen aus einer dunklen Ecke. In einem kleinen Holzverschlag sitzen gebeugt Gestalten und rauchen Zigaretten, aus einer Box tönt Musik.
Der Handel wird hier toleriert – erlaubt ist er nicht
„Da sehen wir nicht alles“, erklärt Meyer. Das bedeutet: In den Raucherbereichen der Einrichtungen wird der Handel „toleriert“. Meyer betont das Wort. „Toleriert – nicht erlaubt“. Denn wenn der Handel nicht drinnen stattfände, dann fände er draußen statt.
Und wenn er draußen stattfände, dann fände er ohne Kontrolle statt. Dann würden Dealer um die Einrichtungen herumlungern, es gäbe Probleme mit der Nachbarschaft. Und so wird der Handel mit kleinen Mengen eben „toleriert“. Aber nur zwischen Konsumenten, Dealer dürfen die Einrichtung nicht betreten. Meyer ist klar: Auch das Angebot lockt Konsumenten in die Konsumräume.
„Du darfst nicht alles konsumieren, was weiß ist.“Mario* (69)
Das sagt auch Mario. Und: Hier in der Anlaufstelle könne er in Ruhe konsumieren, früher sei er draußen von den „Bullen gejagt worden.“ Mario, klein und graue Haare, hat mit 15 angefangen Heroin zu konsumieren, und mit 20 Kokain. Später, erzählt er, kämpfte er in einem Krieg – „Seitdem glaube ich nicht mehr an Gott.“ Er habe Dinge gesehen, die er vergessen möchte. „Das Base macht die Bilder weg.“ Aber süchtig, sagt er, sei er nicht. „Ich schade niemandem. Das geht niemanden was an.“
44 Jahre Heroin und Kokain – wie ist er so alt geworden? „Du darfst nicht alles konsumieren, was weiß ist“, sagt er lachend. Dann steht Mario auf. In seiner Hand hält er eine Pfeife mit Schlauch und blauem Plastikfuß. In ihr schwappt die Flüssigkeit. Freebase ist Kokain, wird mit Ammoniak vermengt und dann erhitzt. Beim Rauchen ist es so reiner.
Mario ist mit seiner Freundin hier, einer jüngeren Frau mit langen, braunen Haaren. Bevor sie nach Hause gehen, wollen sie noch einmal in den Raucherraum. Aber gerade ist nur ein Platz frei. Mario gibt seiner Freundin die Pfeife und lässt sie vor. Gentleman. Nach ein paar Minuten stapft er ihr hinterher.
Fördern Konsumräume den Drogenkonsum? „Nein“, sagt Meyer. „Wir retten Leben.“ Der Drogenkonsum fände sowieso statt. Aber in der Einrichtung können Pfleger und Sozialarbeiter eingreifen, wenn zu viel konsumiert wird. Ungefähr 20-mal pro Jahr rufen die Mitarbeiter der Anlaufstellen einen Krankenwagen. „Diese Leute wären wahrscheinlich gestorben, wenn es die Einrichtung nicht gegeben hätte“, sagt Meyer.
„Schadensminderung“ – eine Säule der Schweizer Drogenpolitik
Die Anlaufstellen arbeiten nicht auf die Abstinenz hin. „Aber wenn sie das wollen, dann unterstützen wir sie“, sagt Meyer über die Klienten. Auch bei anderen Problemen, die sonst vielleicht erst viel zu spät entdeckt worden wären: Wenn sich der Gesundheitszustand von Konsumenten verschlechtert oder die Wohnungslosigkeit droht.
„Schadensminderung“, nennt Meyer das – eine zentrale Säule der Schweizer Drogenpolitik. Und so steht es ja auch in seiner Jobbeschreibung. Auf einem Schrank liegt ein Käppie vom NYPD – der New Yorker Polizei. 2020 waren Polizei und Staatsanwaltschaft vom Big Apple zu Besuch in der Schweiz – heute gibt es auch in New York einen Konsumraum.
Wer verstehen will, warum Zürich den Weg der „Schadensminderung“ geht, muss zum Platzspitz. Kurz hinter dem Hauptbahnhof Zürich fließen hier die Flüsse Sihl und Limmat zusammen, dazwischen ist ein Park: der Platzspitz. In den 1980ern konsumierte die Drogenszene hier offen Heroin und Kokain. Kriminalität, Prostitution, HIV-Infektionen waren die Folgen.
Suchtkranke aus ganz Europa kamen nach Zürich in den sogenannten Needle Park. „Ein riesiges Elend“, sagt Meyer. „Das hat sich eingebrannt in die DNA der Stadt. Ohne den Platzspitz würde es solche Einrichtungen nicht geben.“ Heute kifft am Platzspitz nur noch ein Junge auf der Ufermauer, während Touristen Selfies schießen. Der Straßenlärm ist weit weg, die Bäume im Park blühen, das Wasser der Limmat rauscht durch eine Schleuse.
Experten prüfen Drogen auf ihre Reinheit
Auf der anderen Uferseite steht ein unscheinbares Gebäude. Nur ein paar Plakate neben dem Hauseingang geben einen Hinweis, wer darin arbeitet. „Pillen, Pulver, Kristalle, Flüssigkeiten und Pflanzenteile können zur Analyse abgegeben werden“, steht darauf. Und „Safer Party“ – sicherere Party. Hier ganz in der Nähe vom Platzspitz können Menschen Drogen abgeben, damit die auf ihre Bestandteile analysiert werden. Das Ziel: ein sichererer Konsum. Auch in Baden-Württemberg soll es bald versuchsweise solche Angebote geben.
Das sogenannte Drug-Checking ist ein Angebot des Drogeninformationszentrums Zürich. Im Erdgeschoss des Gebäudes sind Besprechungszimmer und Büros, in denen Sozialarbeiter auf Bildschirme starren und Blumen umtopfen. Sie sehen aus, wie man sich Sozialarbeiter in der Drogenberatung vorstellt: jung, lange Haare, Tattoos.
Dominique Schori leitet das DIZ. Das Drug-Checking, erklärt er, laufe so: Wer eine Substanz prüfen lassen möchte, kann telefonisch einen Termin ausmachen. Bevor eine Substanz geprüft wird, führt ein Mitarbeiter vom DIZ mit dem Besucher ein Beratungsgespräch. Das wird aber offen gestaltet, wie Schori erklärt. Es geht um die Bedürfnisse, die Erfahrungen, das Vorwissen der Besucher – nicht, darum sie vom Konsum abzuhalten.

Dann geben die Besucher eine Pille oder eine kleine Messerspitze von der Substanz ab. Geprüft werden die Proben in einem Labor in Bern. 25.000 Substanzen könne das Labor identifizieren, 60 Substanzen quantifizieren, sagt Schori. So können gefährliche beigemischte Substanzen identifiziert werden. Beispiel Cannabis. In der Schweiz darf Cannabis mit einem THC-Anteil von weniger als einem Prozent legal verkauft werden. Das legale Gras wird dann mit synthetischem THC besprüht und illegal vertickt. „Da gibt es ein sehr hohes Überdosierungsrisiko.“
Ein paar Tage später kann man dann das Resultat abrufen. Mit dabei ist auch ein Konsum-“Hinweis“, wie Schori sagt. „Wenn sehr viel THC im Gras ist, sagen wir zum Beispiel, dass man weniger Gras in den Joint rollen sollte.“ Die Mitarbeiter des DIZ wollen den Konsum nicht verharmlosen, aber so sicher wie möglich gestalten. „Jeder Substanzkonsum ist mit Risiko verbunden, auch wenn nichts anderes beigemischt wurde. Ein Restrisiko bleibt“, sagt Schori.
Das Drug-Checking hat nicht nur für die Konsumenten Vorteile. „Wir haben einen sehr guten Einblick, was auf dem Markt zirkuliert und merken, wenn sich etwas verändert“, sagt Schori.
In einer kleinen Abstellkammer im Erdgeschoss des Gebäudes lagern Pappkartons voll mit Röhrchen und Konsumpapierchen, die man rollen kann, um Koks, Ecstasy und Co. durch die Nase zu ziehen. Daneben steht eine Schale mit Kondomen. Safer Party. Am hinteren Ende des Kämmerchens stehen zwei Tresore, darin lagern Drogen. Auf einem Plastiktütchen, die eine Messerspitze Gras enthält, steht: „Verdacht auf synth. C.“ Verdacht auf synthetisches Cannabis.

Wer lässt sein Cannabis auf synthetische Zusätze checken? Zwar kämen auch suchterkrankte Menschen zum Drug-Checking, aber primär Menschen, die nicht-abhängig konsumieren, sagt Schori. Der Altersschnitt liegt laut ihm etwa bei 35 Jahren, im vergangenen Jahr war die jüngste Person 14, die älteste 79.
Aber das Angebot spreche nicht alle Konsumenten an, glaubt Schori. “Es gibt Menschen, die nicht tagelang auf ein Testergebnis warten wollen. Die spontan konsumieren wollen.“ Auch deshalb soll das DIZ das Angebot ausbauen und bald direkt auf einer Züricher-Partymeile Drug-Checking anbieten, bei dem die Resultate binnen einer Stunde verfügbar sind.
„Sie würden auch ohne uns konsumieren.“Dominique Schori (39)
Ermuntert das zum Konsum? “Wir treffen die Menschen an einem Punkt, an dem sie sich für den Konsum entschieden haben“, sagt Schori. Sie seien beim Dealer gewesen, hätten Geld ausgegeben, hätten sich strafbar gemacht. “Sie würden auch ohne uns konsumieren. So kennen sie aber die Risiken.“
“Sie würden auch ohne uns konsumieren.“ Dieser Satz fasst die Drogenpolitik in Zürich recht gut zusammen. Es ist ein pragmatischer Umgang mit Drogen und Sucht – weniger eine Kapitulation, mehr eine Einsicht: Drogen waren immer schon da und werden wahrscheinlich immer da sein. Oder wie Schori es sagt: “Es gibt keine drogenfreie Gesellschaft. Wir müssen uns fragen: Wie gehen wir mit Menschen um, die Drogen konsumieren? Nehmen wir in Kauf, dass mehr Menschen an einer Überdosierung sterben?“ Oder sollte das oberste Ziel sein: Schadensminderung?
Chillen, Party, Sucht – Die Serie
Dieser Text ist Teil von Chillen, Party, Sucht: Vom Erwachsenwerden mit Drogen, einem Themenschwerpunkt des SÜDKURIER. In der nächsten Folge lesen Sie auf SÜDKURIER Online: Was in Zürich der Platzspitz, ist in Frankfurt das Bahnhofsviertel. In den 90ern hat dort auch Frank Köke Heroin und Koks gefixt. Heute lebt er am Bodensee und ist seit 29 Jahren clean. Wie hat er das geschafft?