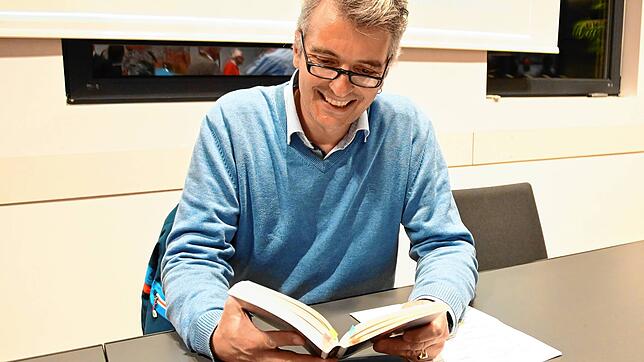Unsere Welt verändert sich rasant. Immer stärker vernetzt sie sich mit dem Digitalen. So findet Kommunikation heute zunehmend über soziale Medien statt. Hier werden Freunde gefunden, Stars geboren, Wahlen gewonnen, Menschen geliebt, gedemütigt und manipuliert.
AfD und Die Linke haben ihre starken Ergebnisse bei der letzten Bundestagswahl auch ihrer cleveren Präsenz auf Instagram und TikTok zu verdanken. Keine Frage, dass Schule Kinder und Jugendliche auf diese neue Welt vorbereiten muss. Soziale Medien gehören ins Klassenzimmer, alles andere wäre unverantwortlich. Denn das Digitale macht unser Leben nur scheinbar einfacher.
Wenige Menschen haben Macht über Milliarden andere
Schon allein die Tatsache, dass die sozialen Medien vor allem von zwei US-Oligarchen mit handfesten wirtschaftlichen und politischen Interessen kontrolliert werden, muss uns zu denken geben. Noch nie hatten so wenige Menschen so viel Macht darüber, was Milliarden Menschen sehen, denken und fühlen. Lange war das gesellschaftliche Klima nicht mehr so polarisiert, so voller Hass und Häme. Und das liegt eben auch an Insta, TikTok, X & Co.
Ab dem kommenden Schuljahr wird es ein neues Fach „Informatik und Medienbildung“ geben. Das ist ein Fortschritt, aber 90 Minuten in der Woche werden nicht reichen, um die Schülerinnen und Schüler fit für die komplizierte digitale Welt zu machen. Das muss in allen Fächern stattfinden.
Eine Frage der politischen Aufklärung
Wenn es um politische Aufklärung geht, sind Geschichte und Gemeinschaftskunde gefordert. Denn ein kritischer Umgang mit Medien – mit Filmen, Texten, Bildern – ist deren Kerngeschäft: Wer hat das Medium gemacht? Welche Absichten und Interessen hat der Verfasser? Welche Botschaften werden vermittelt? Und wie verpackt man sie in einer Fotografie oder in einer Rede?
Die Herausforderung ist, diese Fragen auf die sozialen Medien zu übertragen. Dazu müssen Reels, Memes oder Deepfakes regelmäßiger Teil des Unterrichts werden. Denn sie funktionieren anders als die Medien der analogen Welt. Um geklickt und weitergeleitet zu werden, müssen Posts kurz, aufwühlend und einfach sein. Dabei kümmert es viele Influencer und die Plattformbetreiber nicht, wenn dabei gelogen, gehetzt und manipuliert wird, dass sich die Balken biegen. Womit sie ihr Geld verdienen, sind viele Clicks.
Lebenswirklichkeit im Klassenzimmer
Für die Schule liegt darin ein bedeutsamer Auftrag – und zugleich eine große Chance. Denn mit den sozialen Medien kommt die Lebenswirklichkeit der Schüler ins Klassenzimmer. Dadurch können Themen spannend werden, die für sie bisher langweilig waren.
Nehmen wir als Beispiel die zahllosen Posts, die das Erstarken der AfD mit dem der NSDAP am Ende der Weimarer Republik gleichsetzen und das Ende der Demokratie heraufdämmern sehen. Es gibt ein Meme, auf dem steht: „Es ist wieder 1932“. Darunter sind zwei Fotos von Friedrich Merz und Franz von Papen, einem der letzten Reichskanzler der Weimarer Republik.
Ist es wieder 1932?
Für viele Schüler ist das irritierend und beunruhigend. Steht wirklich der Untergang der Demokratie bevor? Da muss man zunächst lernen, die Unsicherheit in klare Fragen zu übersetzen: Wer hat das gepostet, und was will derjenige eigentlich sagen? Glaubt er wirklich, dass der Untergang der Demokratie bevorsteht?
Oder will er mit seinem Post zur Wachsamkeit mahnen? Und auf einmal wird Geschichte richtig wichtig: Wer war Franz von Papen? Warum ging die Weimarer Republik unter? Und kann man das auf heute übertragen? Ist die AfD wie die NSDAP? Merz wie Papen?
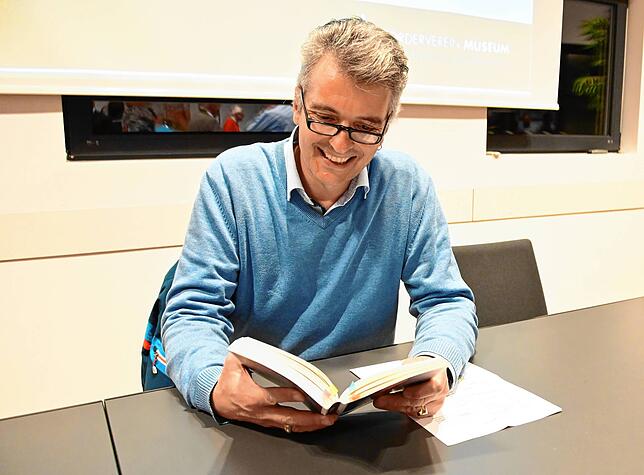
Schüler lernen, kritisch hinzuschauen
Wenn Schüler am Ende verstanden haben, dass ein genauer Blick in die Geschichte helfen kann, die Gegenwart besser zu verstehen, man aber niemals Damals und Heute gleichsetzen kann, haben sie viel gelernt. Und wenn sie erkennen, dass Geschichte oft auf manipulative Weise benutzt wird, sich dahinter immer Interessen verbergen, dass jeder Post kritisch geprüft werden, man bei jedem Click sein Hirn einschalten muss, macht der Lehrer einen Freudensprung.
Was Schüler auch verstehen müssen: Als Nutzer sozialer Medien sind sie zugleich auch Mitgestalter: Durch Likes, Kommentare, eigene Tweets oder Reels erschaffen sie das digitale Universum mit. Wer ein russisches Deepfake oder einen rassistischen Trump-Tweet teilt, hilft bei der Verbreitung der Botschaft. Und wird in Zukunft nur noch ähnliche Posts erhalten.
Jeder Like hat Konsequenzen
Wer selbst etwas postet, muss mit Nichtbeachtung oder einem Shitstorm rechnen. Das kann enttäuschend und sehr verletzend sein. Auch darauf muss Schule Schüler vorbereiten. Sie müssen nicht nur verstehen, wie man soziale Medien analysiert, sondern auch, welche Verantwortung sie für jeden Post tragen. Und welchen Risiken man sich aussetzt.
Jeder Like hat Konsequenzen. Von daher kann es sinnvoll sein, als Klasse über einen anonymen Account, den der Lehrer einrichtet, etwas zu posten, zum Beispiel einen Kommentar zu dem Meme über 1932. Oder man kreiert eigene Memes zu dem Thema. Und beobachtet, welche Reaktionen sie hervorrufen.
Wichtig sind die gemeinsamen Diskussionen: Ist unser Post witzig? Manipulativ? Verletzen wir damit andere? Es soll ja nicht darum gehen, soziale Medien zu verteufeln, sondern einen ethischen, kompetenten und gesunden Umgang mit ihnen einzuüben. Schüler sollen ein Gespür dafür entwickeln, wem im Netz zu trauen und was gut für sie ist.
Die Schule allein kann die Welt nicht retten
„Digitalisierung first, Bedenken second“ – diesen Spruch plakatierte die FDP bei der vorletzten Bundestagswahl. Diese Haltung ist so gefährlich wie naiv. Elon Musk beeinflusst über Algorithmen auf X, welche Nachrichten sich wie stark verbreiten. Marc Zuckerberg will von einem Faktencheck bei Facebook, Insta & Co nichts mehr wissen. Sein Geschäft sind die Daten, die er über Posts gewinnt – und weiterverkaufen kann.
Und weil Hass, Häme und Hetze Clicks provozieren, werden solche Posts kaum gehemmt. Wir Nutzer sind da ziemlich machtlos; die Regeln der sozialen Medien werden nicht von uns, sondern von deren Besitzern bestimmt. Wollen wir das als Gesellschaft wirklich so hinnehmen?
Die Schule allein wird die Welt nicht retten können. Zwar können wir Lehrer es mit gutem Unterricht wohl schaffen, Schüler zu kompetenteren Nutzern zu erziehen. Doch Influencer werden immer raffiniertere Strategien erfinden.
Wollen wir das gesellschaftliche Klima verbessern, soziale Medien ethischer machen und die Demokratie erhalten, muss die Politik die monopolartige Macht sozialer Medien brechen: Algorithmen müssen offen gelegt und öffentlich kontrolliert, die Betreiber der Plattformen für die Verbreitung von Hass, Hetze und Fake News verantwortlich gemacht werden. Außerdem muss die Altersbeschränkung für soziale Medien (13 Jahre bei TikTok, X und Instagram) konsequent durchgesetzt werden.
Sehr befremdlich, dass dies die Politik bisher kaum zu interessieren scheint. Ob das an der Angst vor übermächtigen Männern liegt?