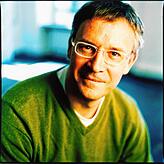So lang ist er gar nicht. Mit seinen rund 1200 Kilometern landet der Rhein in Europa auf Rang sieben – noch hinter Gewässern wie Petschora oder Dnestr. Und doch scheint es, als liege ihm die ganze Welt zu Füßen. An diesem Fluss wurden Schlachten entschieden und Nationen begründet, in seinem Lauf zeichnen sich die Hoffnungen und Tragödien der Menschheit ab. Niemand kennt uns besser als Vater Rhein: unsere Herkunft, unsere Gegenwart und unsere Zukunft.
Die verborgenen Geschichten des Rheins
Von der „Gegenwart aller Augenblicke“ spricht Hans Jürgen Balmes. Der Autor ist in Koblenz aufgewachsen, wo Rhein und Mosel zueinander finden, und hat viele Jahre lang den Rhein erwandert und mit dem Kajak befahren. Von Kindheit an waren ihm die Sinneseindrücke dieses geschichtsträchtigen Ortes vertraut, die rosa blühenden Weinbergpfirsiche ebenso wie das Rasseln der Güterzüge. Er sich auf die Suche nach den verborgenen Geschichten des Rheins begeben.
Das Ergebnis ist eine beeindruckende Natur- und Kulturgeschichte über den Rhein und die Seele einer Landschaft, im Lauf von Abermillionen Jahren. Balmes schildert das Über-Leben einzelner Vogel- und Fischarten, die Wandlung des Rheins von einem ungebändigten Strom zu einer europäischen Transportroute. Seine „Biographie eines Flusses“ (S. Fischer Verlag) ist in Wahrheit ein Beziehungsroman: Er handelt von den großen Leidenschaften und erbitterten Kämpfen, von intimer Nähe und kühler Distanz zwischen Mensch und Natur.
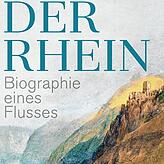
Es beginnt schon gleich nach der Quelle in der Via Mala, wo wir statt eines schiffbaren Stroms noch einen reißenden Gebirgsbach sehen. Wäre es nach Pietro Caminada gegangen, bekäme der Bergwanderer heute in dieser Schlucht statt Fischen und Schmetterlingen wuchtige Lastkähne zu Gesicht. Die 1905 veröffentlichten Pläne des italienischen Erfinders hatten es in sich: Vom Comer See aus hätte eine transalpine Wasserstraße bis zum Bodensee entstehen sollen.
Ein Schiffstunnel am Splügen-Pass
Zum Eingang eines 15 Kilometer langen Tunnels unterhalb des Splügen-Passes wären die Frachtschiffe über spektakuläre Röhrenkanäle gelangt. Durch das Fluten eines solchen Kanals wäre es möglich gewesen, das Schiff bis auf 1250 Höhenmeter zu befördern. Basel hätte plötzlich näher am Mittelmeer gelegen als an der Nordsee, und die Schweiz wäre zum Knotenpunkt des internationalen Seehandels aufgestiegen.
Dieser Wahnsinn ist dem Rhein erspart geblieben, an anderer Stelle wurden die Ideen größenwahnsinniger Ingenieure jedoch Wirklichkeit. Dabei hatte Johann Gottfried Tulla (nicht Georg, wie es bei Balmes heißt) keineswegs die heutige Wasserstraße im Sinn, als er zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Begradigung des von Mäandern geprägten Flusses im Oberrheingraben plante. Statt der Schaffung florierender Handelswege ging es um die Nöte der Anrainer und der Politik: Ständig trat der Fluss über die Ufer, setzte Äcker unter Wasser, verbreitete Krankheiten und löste mit seinen immer neuen Verläufen Konflikte aus.
Keine Laichgründe mehr
Manches Problem sollte die Begradigung tatsächlich beheben, so galten Typhus, Ruhr und Malaria bald als besiegt, und wo einst Sumpfgebiet war, konnten die Bauern nun Getreide säen. Doch der Preis war hoch: Die höhere Fließgeschwindigkeit brachte das Hochwasser mit umso größerer Wucht weiter stromab. Derweil fanden Tiere wie Lachs uns Stör keine Laichgründe mehr, und die fortschreitende Industrialisierung gab der Fischpopulation mit ihren Abwässern den Rest.
Mit allen möglichen Maßnahmen versucht der Mensch diesen Folgen seines Handelns gegenzusteuern. Doch was er auch versucht: Es ist immer der Wurm drin. Als man beispielsweise merkte, dass seit Bau der Wasserkraftwerke hinter Stein am Rhein der Lachsbestand zurück ging, errichtete man Fischtreppen. Hilft nur nichts. Denn beim Weg zurück geraten die geschlüpften Jungtiere in die Turbinen der Anlage.
Das Naturschutzgebiet Kühkopf soll Zugvögeln wieder Nistplätze bieten. Doch im Norden kreuzen die Flieger des Frankfurter Flughafens ihren Weg, im Süden stehen die Schlote des Industriezentrums von Mannheim-Ludwigshafen. „Jede Lösung stellt ein neues Problem“, bilanziert Balmes.
Es ist, als liege eine tiefere Ahnung im stetigen Bemühen um Wiedergutmachung verborgen, die Einsicht, dass dieser Fluss uns mehr bietet als nur einen günstigen Verkehrsweg. Der britische Maler William Turner sucht den Rhein immer wieder auf, fertigt auf Bootsfahrten penible Skizzen an, die ihm zuhause im Atelier als Grundlage für großflächige Gemälde dienen. Ein 1845 entstandenes Bild nimmt die abstrakte Kunst des 20. Jahrhunderts vorweg. Die Identität des gezeigten Ortes ist nicht ganz klar, Balmes spricht vom Schaffhauser Rheinfall: In jedem Fall wirkt der im weißen Nebel auftauchende diffuse Wirbel aus Gold-, Rot- und Blautönen wie ein Sinnbild auf die politischen Umwälzungen dieser Zeit.

Als in den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts der Fotograf August Sander einen Bildband über die Menschen am Rhein plant, kommt ihm das NS-Regime in die Quere. Es hätten darin alle Gesellschaftsschichten Platz finden sollen, Reiche wie Arme, Starke wie Schwache, auch Roma und Schwarze. Das passt freilich schlecht zum erwünschten rassistisch bereinigten Idealbild. Und so darf er nur die Landschaft zeigen, möglichst ohne Menschen. Den Schauplatz der Nibelungensage kann man ja gar nicht ohne den erwünschten Heroismus abbilden, wird man sich gedacht haben.
Doch auch das hat der Rhein parat: Sander lässt den Erpeler Ley tief schwarz wie einen Vorboten des Unheils in die unbewegte Wasserfläche ragen. Dämonisch statt heroisch wirkt der Fluss hier, und nicht ans Rheingold mag der Betrachter denken, sondern an den Styx, der nach antikem Glauben geradewegs zur Unterwelt führte.
Werden und vergehen
Aufstieg und Untergang, werden und vergehen: Vielleicht liegen diese Gegensätze nirgends näher beisammen als am Rhein. Und es ist das Verdienst von Hans Jürgen Balmes, uns dieses Spannungsverhältnis auf so poetische, jedem Anflug von Belehrung enthobene Weise nahezubringen.
Überhaupt sind die Widersprüche von Prozessen wie Migration und Globalisierung kaum an einem anderen Ort eindrucksvoller zu erfahren. Deutlich wird das im Mündungsdelta, wo einst Tausende vor der Hungersnot geflüchtete Pfälzer strandeten und später nach Amerika auswanderten. Und wo heute eine Deponie so viel Giftmüll beherbergt, dass man daraus eine zweieinhalb Meter hohe Mauer rund um den Erdball bauen könnte.
Es gibt kein geeignetes Endlager für diesen brandgefährlichen Auswurf unseres toxischen Lebensstils. Deshalb liegt es bis auf Weiteres hinter einem Deich, den zu überwinden rein rechnerisch nur eine alle 10.000 Jahre eintretende Sturmflut in der Lage wäre. Wird schon gut gehen, lautet das unausgesprochene Motto dieser Wette mit dem Schicksal. Und wenn nicht, hat uns der Rhein vielleicht seine letzte Lektion erteilt.