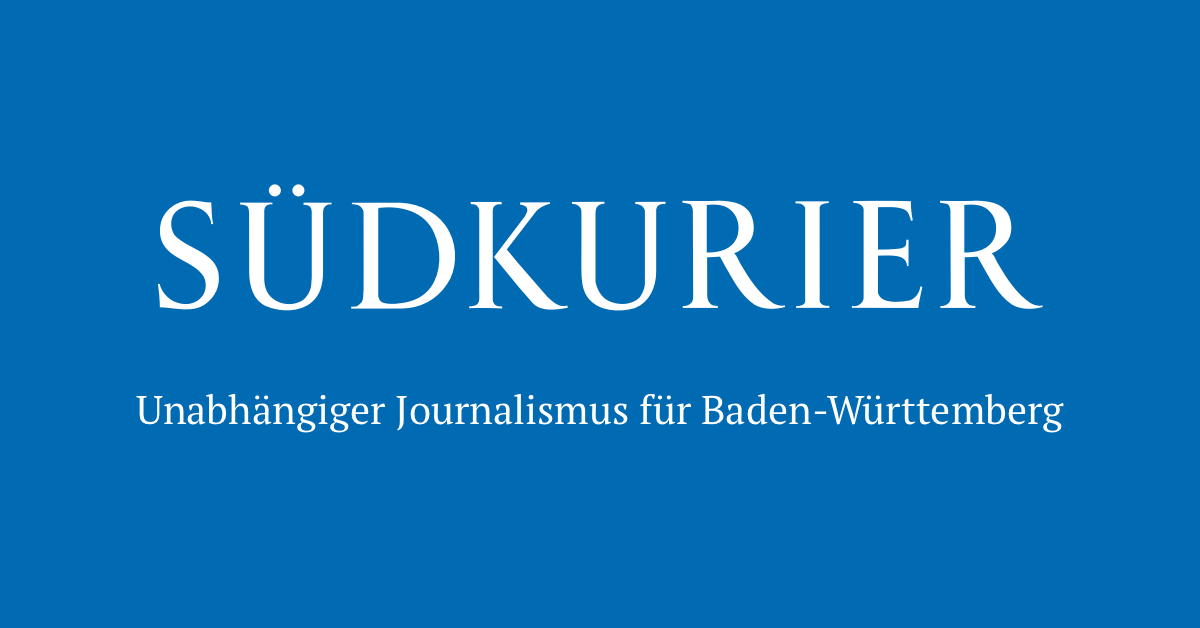Vor 30 Jahren war die Welt zwischen Konstanz und Basel noch eine andere. Jeden Samstag überquerten deutsche Kunden die Grenze, um sich in den Schweizer Supermärkten mit günstigen Lebensmitteln einzudecken. Nudeln, Schokolade, Zigaretten – vieles war billiger im Nachbarland. Längst vorbei und vergessen. Wenn nicht gerade Corona-Pause ist, sind es die Schweizer, die über die Grenze strömen, um im Billigparadies Deutschland einzukaufen. Ganze Branchen an Rhein und Bodensee leben davon.
Ein besseres Verständnis füreinander hat sich nicht entwickelt. Das Drama um das gescheiterte Rahmenabkommen mit der Europäischen Union zeigt, wie fremd sich die Schweiz und der Rest Europas geworden sind – Deutschland und Südbaden inklusive. Es ist fraglich, ob der Bundesrat in Bern dem Land mit seiner Entscheidung gegen den Vertrag einen Gefallen getan hat. Genauso bedenklich ist aber das Echo aus der EU: Kaum hatte die Schweiz die Verhandlungen für beendet erklärt, drohte die Kommission mit einer Politik der Nadelstiche – bis hin zur albernen Ankündigung, Tomatenlieferungen aus Drittländern unterbinden zu wollen. So kann man vielleicht Weißrussland behandeln. Aber die Schweiz?
Bitte mehr Respekt vor einer demokratischen Entscheidung
Klar, auch der Nachbar muss lernen, sich zu bewegen. Gerade die Jüngeren im Land wollen mehr Europa, nicht weniger. Trotzdem hat auch die EU allen Anlass, in sich zu gehen. Manche ihrer Reaktionen lassen den Respekt vor einer demokratischen Entscheidung eines demokratischen Landes vermissen, so als hätte sie aus dem Brexit nichts gelernt. Die Europäische Union ist ein Staatenbündnis, das auf Freiwilligkeit beruht – das macht ihren Kern aus. Niemand muss ihr beitreten, niemand muss mit ihr Verträge schließen, selbst wenn es vernünftiger wäre, dies zu tun. Wie sich am Beispiel der Schweiz zeigt, atmet nicht alles, was aus Brüssel kommt, diesen Geist. Gerade weil viele Schweizer das Gefühl hatten, die EU wolle sie mit Drohungen gefügig machen, schalteten sie auf stur. Sonderlich viel hat sich nicht verändert seit dem Rütlischwur vor mehr als 700 Jahren, als sich die eigensinnigen Eidgenossen gegen die Habsburger Fremdherrschaft verbündeten.
Der Schaden, der entstanden ist, liegt somit weniger in den wirtschaftlichen Konsequenzen dieser Pleite. Bei gutem Willen auf beiden Seiten bleiben sie überschaubar, zumal die Schweiz der EU mit einem Geflecht aus mehr als 120 Verträgen eng verbunden bleibt. Tückischer ist das Gift für das nachbarschaftliche Verhältnis. Von Europa sind die Schweizer weiter entfernt denn je. Der Verhandlungsabbruch ist ein ähnliches Fanal wie das Nein der Schweizer Stimmbürger 1992 zum Europäischen Wirtschaftsraum, das dem Land den Weg in die Europäische Union verbaute. Auch diesmal gaben dieselben alten Ressentiments den Ausschlag. Sie lauten: Die EU ist nicht viel besser als seinerzeit die Habsburger. Wer sich an sie kettet, hat nicht mehr viel zu melden.
Warum die Schweiz so hart bleibt
Es ist das ganz andere Verständnis von Staat und Demokratie, das die Verhandlungen erschwerte und den Vertrag am Ende in den Reißwolf beförderte. Für die EU drehte sich alles um Freizügigkeit, fairen Marktzugang und, ja auch, das berechtigte Verhindern von Rosinenpickerei. Für die Schweizer ging es um Grundsätzlicheres, zum Beispiel um die Frage, ob im Streitfall der Schweizer Stimmbürger oder aber ein europäisches Schiedsgericht das letzte Wort hat. Der EU beizutreten, bedeutet, nationale Souveränität abzugeben. Eine direkte Demokratie wie die Schweiz, die gewohnt ist, selbst beim Bau einer Mehrzweckhalle das Volk zu fragen, tut sich damit naturgemäß schwerer als Länder, in denen Parlamente entscheiden und die Regierenden ungleich mehr Beinfreiheit haben. Bezeichnenderweise kämpften nicht nur Christoph Blocher und die Rechte gegen das Rahmenabkommen, sondern auch das Gewerkschaftslager mit seiner Angst vor billigen ausländischen Arbeitskräften.
Die Grenzregion trägt die Folgen
Die EU hat bis heute keine Antwort auf solche Befindlichkeiten. Selbst viele Deutsche, die näher an der Grenze wohnen und es besser wissen müssten, zucken mit den Achseln. Dabei wird vor allem die Grenzregion die Folgen am stärksten spüren, wenn die Entfremdung weiter wachsen sollte. Viele Probleme machen an Schlagbäumen nicht halt, vom Coronavirus bis zum Fluglärm, ganz zu schweigen von den Auseinandersetzungen, die auf die Region zukommen werden, wenn die Bagger für den Bau eines grenznahen Atomendlagers anrollen sollten. All diese Konflikte lassen sich nur gemeinsam lösen. Möglich ist das nur, wenn beide Seiten nicht Mauern bauen, sondern Brücken. Das EU-Abkommen wäre, allen Einwänden zum Trotz, eine gewesen. Nun werden nach sieben Jahren Bauzeit die Pfeiler abgerissen. Schade.