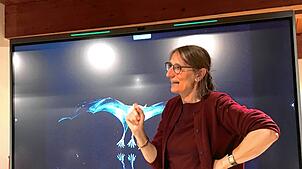Frau Berger-Geiger, Sie reisen Jahr für Jahr im Frühling in die spanische Extremadura, um dort Wiesenweihen-Nester zu betreuen. Seit wann machen Sie das?
Ich bin das erste Mal 1999 dorthin gefahren. Da war ich allein und habe erstmal die Wiesenweihen kennengelernt. Danach fand ich die Vögel so faszinierend, und dann wurde es eine richtige Kampagne.
Wie kamen Sie denn darauf, ausgerechnet in Spanien Vogelnester zu betreuen?
Das hängt mit meiner persönlichen Situation zusammen. Ich habe gedacht, die Kinder sind groß genug, die kann ich auch einmal eine Weile daheim allein lassen. Aufgrund von meinem Studium der Agrarbiologie wollte ich gerne Naturschutzarbeit in Spanien machen, auch um mein Spanisch wieder etwas aufzubessern.
Wie kamen Sie dann zu dieser Arbeit mit den Wiesenweihen?
Es gibt dort eine Naturschutzorganisation, Adenex, vergleichbar mit dem Nabu. 1999 sollte über ganz Spanien und Portugal eine Kampagne zum Schutz der Wiesenweihen gestartet werden. Ich habe bei Adenex angefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, Naturschutzarbeit zu machen. Die bejahten das, und so kam ich dahin und habe zum ersten Mal überhaupt Wiesenweihen gesehen. Es war also Zufall, es war nicht Liebe auf den ersten Blick.
Worin besteht denn die Arbeit?
Die Wiesenweihen brüten im Getreide, ihre Nester sollten lokalisiert und gekennzeichnet werden. Dann sollten die Bauern bei der Ernte dieses Nest umfahren.
Was machen Sie da ganz konkret?
Bei den Wiesenweihen versorgt das Männchen das Weibchen mit Futter. Das Weibchen brütet fast ausschließlich allein. Das Männchen kommt angeflogen, ruft das Weibchen. Das Weibchen steigt hoch, das Männchen übergibt das Futter in der Luft. Dann geht das Weibchen mit der Beute zurück ins Nest. Dabei muss man dann sich genau einprägen, wo das Weibchen runtergegangen ist, und dann diesen Punkt anlaufen.
Es geht eigentlich nur mit einem Zweierteam. Der erste merkt sich, wo das Weibchen heruntergegangen ist und schickt dann den zweiten, dirigiert über ein Sprechfunkgerät, zu diesem Punkt. Wenn der zweite Mann oder die zweite Frau dort ankommt, fliegt der Vogel hoch. Dann hat man das Nest. Mit einem GPS-Gerät setzt man einen Wegpunkt, gibt dann diesen per Sprechfunk durch, sagt auch wie viele Eier oder wie viele Küken im Nest liegen und wie alt die Küken etwa sind, wie hoch das Getreide ist. Der andere protokolliert das.
Wer hilft Ihnen denn bei der Arbeit?
Am Anfang war ich tatsächlich allein und habe schnell gemerkt, dass es eben allein gar nicht geht. Ich kann mir zwar den Punkt merken, aber wenn ich losgehe, kann es sein, dass ich über einen Zaun steigen muss und dabei die genaue Richtung verliere. Bis zu 50 Meter Entfernung ist es möglich, die Nester zu finden. Aber da geht natürlich in der Regel kein Vogel runter, wenn ich da als Beobachter stehe. Wenn man im Auto sitzt, kann es schon sein, dass ein Vogel runtergeht. Dann kann man das nahe Nest auch allein finden.
Ich habe gemerkt, es geht nur zu zweit. Ich habe dann in den ersten Jahren jemanden von meiner Familie mitgenommen, meinen Mann – der inzwischen zum festen Team gehört – oder auch die Kinder. Nach fünf Jahren habe ich auch im Freundeskreis versucht, Mitarbeiter zu finden und für die Arbeit zu begeistern. So habe ich nach und nach eine beträchtliche Anzahl an Mitarbeitern gewonnen.

Hat sich im Laufe der Jahre die Arbeit verändert?
Nach wie vor das Wichtigste ist es, die Nester zu finden. Wie sie dann geschützt werden, das hat sich deutlich verändert. Am Anfang haben wir nur mit Plastikstreifen an den Getreidehalmen die Nester gekennzeichnet, so dass der Mähdrescherfahrer das von oben sehen konnte und wusste, da muss er außen rumfahren. Das war der einzige Schutz. Das ging so in etwa bis 2011. Dann haben wir gemerkt, dass die Nester ausgenommen werden, wahrscheinlich durch einen Fuchs.
Das war vorher nicht der Fall?
Nicht in dem Maße. Da wurden die Nester in den stehen gebliebenen Getreideinseln weniger ausgenommen. Aber ab 2011 konnte man ziemlich sicher sein, dass 80 bis 90 Prozent der Getreideinseln vom Fuchs ausgenommen wurden.
Was haben Sie dann gemacht?
Dann haben wir begonnen, die Nester zu umzäunen. Und zwar nur dann, wenn Jungvögel drin waren. Wenn nur Eier drin waren, bestand die Gefahr, dass das Weibchen das Nest aufgibt durch die Belästigung durch den Zaun. Der Zaun ist ja schon ein ziemlicher Fremdkörper für den Vogel. Wir haben dann auch Kameras aufgestellt, schon bevor wir die Nester umzäunt hatten, weil wir wissen wollten, was da passiert. Wir haben gesehen, dass die Mehrzahl der Nester durch den Fuchs ausgeräubert wird. Der holt die Eier, der holt die Küken, er ist nicht wählerisch und holt alles.
Als wir dann die Nester umzäunt haben, hatten wir weniger Verluste. Aber im Jahr 2019 ist der Fuchs sogar über den Zaun gesprungen. Der Zaun war 1,40 Meter hoch. Wir konnten das mit der Kamera belegen. Daraufhin haben wir am Zaun oben trapezförmige Zaun-Elemente angebracht, um dem Fuchs den Weg zu versperren. Das hat auch soweit funktioniert.
Nun ist das für die dortigen Bauern sicher lästig, wegen so ein paar Vogelnestern mit ihren Erntemaschinen Umwege zu fahren. Wie haben Sie die Bauern für Ihre Aktion gewinnen können?
Der Vogel ist geschützt und die Bauern dürfen die markierten Nester nicht überfahren. Wenn das zur Anzeige gebracht wird, zahlen sie kräftige Strafen. Ansonsten wurde auch vom Staat Entschädigung gezahlt.
Haben die Wiesenweihen denn keine anderen Nistmöglichkeiten als ausgerechnet in Kornfeldern?
Früher gab es Brachflächen, Heideflächen, also natürliche Habitate, wo die Wiesenweihen gebrütet haben. Die gibt es heutzutage so gut wie nicht mehr. Und wenn die Vögel aus Afrika zurückkommen, bieten Getreidefelder die beste und dichteste Deckung, sodass sie zu 95 Prozent ins Getreide gehen.
Haben sich die Bedingungen verändert, angesichts des Klimawandels zum Beispiel?
Ja, schon. Wir haben immer heißere Sommer. 2022 hatten wir extreme Hitzeperioden im Juni. Viele Jungvögel in den Nestern sind durch Austrocknung gestorben. Die Männchen haben zum Teil auch nicht mehr so viel Futter gebracht. Wenn es 50 Grad oder sogar noch mehr in der Sonne hat, dann sind die Vögel eben auch nicht mehr so fit. Wir haben das auch mit Kameras dokumentieren können. Aber es war unterschiedlich. Manche Männchen haben nach wie vor zuverlässig Futter gebracht. Die Weibchen haben versucht, Heuschrecken zu fangen, um die Jungen zu füttern. Aber die waren generell eben in einem schlechten Ernährungszustand. Ganz viele Jungvögel sind daher gestorben.
Aber wenn man die Vögel überhaupt noch retten oder ihren Bestand stabilisieren will, dann bleibt die Arbeit nach wie vor aktuell. Und noch zum Klimawandel: Wir hatten vergangenes Jahr extreme Dürre, als die Vögel gekommen sind. Das Korn war ganz locker. Dann gab‘s Ende Mai, Anfang Juni extreme Regenfälle. Die haben dazu geführt, dass manche Nester unter Wasser gestanden sind. Die Eier sind im Wasser geschwommen. Ein weiterer Effekt war, dass durch den extremen Regen der Boden wie ein Pudding war, und der Fuchs sich dann unter den Zaun hindurch Zugang zum Nest verschaffen konnte.
Wie sehen denn die Zahlen aus? Wie viele Nester haben Sie denn im Schnitt pro Jahr retten können?
Am Anfang, als ich nur mit Familienmitgliedern Nester gesucht habe, waren wir so bei 50, 60. Als dann noch weitere Freiwillige mithalfen, kamen wir auf an die 170 Nester im Gebiet. Und seit 2012 sind wir wieder auf dem absteigenden Ast. Jetzt sind wir bei 80 maximal. Die Population hat sich in den 25 Jahren halbiert.
Mittlerweile besendern Sie ja einige der Wiesenweihen. Was erfahren Sie so über deren Verbleib?
Die Wiesenweihe ist ja ein obligatorischer Zieher. Die fliegen alle nach Afrika, südlich von der Sahelzone. Sie kommen zurück im März, April. Wir haben auch schon Jungvögel besendert. Die Jungvögel sind ganz unabhängig voneinander erst einmal in Spanien herumgeflogen und dann erst nach Afrika. Ganz spannend wäre es jetzt zu sehen, was sie im zweiten und dritten Jahr machen. Ob sie dann Gebiete anfliegen, die sie auf ihren Erkundungsflügen in Spanien kennengelernt haben oder ob sie ganz neue Gebiete anfliegen. Wir hatten im vergangenen Jahr einen Vogel, der ein ganz neues Gebiet angeflogen und dort gebrütet hat.
Was hat die Arbeit mit Ihnen gemacht?
Die Arbeit hat in mir noch mehr Neugierde geweckt. Die Vögel sind so faszinierend, und je mehr man von ihnen erfährt, durch die Besenderung oder auch durch die Nestkameras, umso mehr Fragen tauchen wieder auf. Es geht immer weiter. Ich glaube nicht, dass man mal zum Abschluss kommt. Wir haben auch gesehen, dass Weibchen, die ihr Nest verloren haben, in ein anderes Nest gehen und dort bei der Aufzucht helfen.
Wie lange wollen Sie das noch machen? Sie sind jetzt 72.
Solange ich das machen kann, fände ich das toll. Ich will das auch noch nicht abgeben. Das Schwierige ist, wenn man junge Freiwillige hat, Studenten etwa, die finden das für einmal ganz toll, machen dann aber etwas anderes. Schwierig.