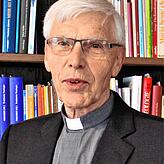Die vergangenen fünf Monate waren für Georg Gänswein ein Spießrutenlauf. Erst stirbt am Silvestermorgen Benedikt XVI., der für ihn Vorbild, Vorgesetzter und spiritueller Vater war. Dann entfachte er durch sein Buch „Nichts als die Wahrheit“ einen Sturm, der sich bis heute nicht gelegt hat.
Im Hintergrund stand stets die Frage, was aus dem ehemaligen Papstsekretär nun wird. Denn nach dem Tod von Joseph Ratzinger ist Gänsweins Mandat in Rom abgelaufen. Die stille Hoffnung seiner Anhänger, dass sich für den Kurienerzbischof etwas adäquat Hochrangiges finden lässt, hat sich zerstreut.
Das hat ihm der Papst in ungewöhnlich deutlichen Worten sagen lassen. Dass er wieder nach Hause soll – so wie auch andere Sekretäre den Weg in die Heimat antraten. Dass Franziskus diesen Bann eher beiläufig und im Rahmen eines Interviews verhängte, macht die Sache nicht besser. Sie ist demütigend für den ehemaligen Senkrechtsstarter Gänswein – und kein gutes Exempel für eine diskrete Personalpolitik.
Er stand stets im Vordergrund
Der Wind, der durch die Kommentarspalten weht, dreht sich seitdem. Wurde anfangs des Jahres noch kritisiert, dass sich der Ratzinger-Intimus auch während des Requiems in den Vordergrund drängt und gleichzeitig die ersten knalligen Sätze aus seinen Memoiren in italienischen Zeitungen stehen, überwiegt inzwischen das Mitgefühl. Hat er dem alten Papst nicht hingebungsvoll gedient? Und nun das: Er wird förmlich aus Rom vertrieben, zu einer Person erklärt, die man im Vatikan und in Italien nicht mehr sehen will.
Tragisch daran: Georg Gänswein ist an dem scharfen Schnitt, den der Papst vornimmt, direkt beteiligt. Wer seine Chronik der vergangenen zwei Jahrzehnte durchblättert, in denen er erst dem Präfekt, dann dem Papst diente, der wird eine Regelmäßigkeit erkennen. Gänswein, der gebürtige Schwarzwälder, stand nicht im Schatten seines Chefs, sondern immer neben ihm.
Es gibt fast kein Bild von Benedikt XVI. ohne elegantes Agieren des damals jugendlich wirkenden Assistenten. Dessen Vorgänger im Sekretärsamt hielten sich noch zurück. Sie waren Kofferträger, brachten das Wasserglas, sperrten die Tür auf. Anders Gänswein. Er drängte in den Vordergrund, sichtbar für alle. Der weißhaarige Pontifex und der sportliche Monsignore an seiner Seite – dieses unzertrennbare Doppel prägt das ikonische Bild der Ära Ratzinger. Es waren strahlende Zeiten für den Schwarzwälder Priester mit den leuchtenden Augen.
Manchen war er zu mächtig geworden
In der Amtszeit von Benedikt XVI. (2005 bis 2013) war Gänswein unangreifbar. Er wohnte und arbeitete im Apostolischen Palast, de facto als eine Art Generalsekretär. Dazu kommt, dass Papst Benedikt den PC nicht nutzte. Den Mailverkehr, der auch den Vatikan speist, erledigte Georg Gänswein. Damit war er bestens informiert. Der Zugang zum Papst lief über ihn, zumal er später noch zum Präfekten des päpstlichen Hauses aufrückte, nachdem sein Vorgänger versetzt worden war.
Das mehrte seinen Radius, was Freund und Feind nicht verborgen blieb. Auch das erklärt, weshalb sich aktuell kaum eine Hand für Gänswein rührt: Er war mächtig geworden, einigen wohl zu mächtig. Der Gehilfe aus Riedern am Wald im Kreis Waldshut war zur Grauen Eminenz aufgerückt. Und zugleich entrückt.
Entrückt vor allem seiner Heimat gegenüber. Während er in den Medien noch immer als „Sohn des Schwarzwaldes“ vorgestellt wurde, wuchs die Distanz über die Jahre. Georg Gänswein war Römer geworden – wie mancher andere auch, der Karriere in der Ewigen Stadt gemacht hatte und es sich nicht vorstellen konnte, den Ruhestand im stillen Brunnen einer süddeutschen Landgemeinde zu verbringen.
Bereits zu Freiburger Studienzeiten galt „der Schorsch“ als einer, der auf gute Umgangsformen Wert legte – und nicht unbedingt mit jedem redete. Das berichten ehemalige Kollegen aus dem Borromäum (dem erzbischöflichen Seminar). Die Karriere in Rom unter den Fittichen des damaligen Glaubenswächters Ratzinger hat den Abstand vergrößert.
Auch kirchlich trennten sich die Wege; Gänswein lehnt vieles ab, was deutsche Katholiken umtreibt. Der Synodale Weg beispielsweise erscheint ihm als Irrweg. Die katholische Kirche soll sich nicht ändern, sondern sich bewahren.
Franziskus unter den Wölfen
Das folgenschwerste Kapitel in der Chronik von Aufstieg und Fall wurde 2013 aufgeschlagen – dem Jahr, in dem Benedikt XVI. vom Papstthron stieg und ein Mann aus Argentinien daraufgesetzt wurde. Franziskus meinte es gut mit Gänswein, er ließ ihn auf dem Posten des Protokollchefs. Sieben Jahre füllte Gänswein das Amt aus, dann vollzog der Papst den Schnitt und „beurlaubte“ ihn – faktisch war das der Sturz.
Der gefallene Präfekt hat sich das selbst zuzuschreiben. In den Jahren nach Benedikt gab es Intrigen gegen Papst Franziskus. Gänsweins Name fiel immer wieder, wenn die Gegner des Argentiniers aufgezählt wurden. „Franziskus unter Wölfen“, so fasst der Vatikanist Marco Politi die Stimmung in den ersten Jahren nach der Ära Ratzinger zusammen.
Für eine stille Opposition sah der konservative Flügel der Kirche auch allen Grund. Es fing an mit dem Erscheinungsbild des damals neuen Papstes: Er verzichtete vom ersten Tag auf Kleidungsstücke, die Benedikt bei seinem Amtsbeginn aus alten Kleiderkammern hervorholte.
Auch im Grundsätzlichen gähnt ein tiefer Graben zwischen Ratzingers Kirchenbild und jenem von Jorge Bergoglio. Er wünsche sich eine „verbeulte Kirche“, sagte Franziskus. Mit der Welt des bayrischen Barock ist eine ramponierte Kirche, die mitten in der Welt steht und aneckt, nicht vereinbar. Der konservative Flügel war verstimmt über die revolutionären Ansätze, die Papst Franziskus in seinen ersten Jahren zeigte.
Erst Privatsekretär, dann Privatmann
Deutlich zeigte sich das im Streit ums Zölibat. Erneut wurde dem Kurienerzbischof de Rolle als Diener zweier Herren zum Verhängnis – und das vor aller Öffentlichkeit. Im Herbst 2019 war eine Situation entstanden, in der die Lockerung des Zölibats auf dem Tisch lag.
Möglich gemacht hatte dies die Amazonas-Synode, die auf den Priestermangel in den Dörfern der Indigenen aufmerksam machte. Wie wäre es, so der Vorschlag, wenn verheiratete Diakone zu Priestern geweiht würden? Die Synode sprach sich dafür aus mit breiter Mehrheit. Der Papst Franziskus hat den Vorstoß am Ende blockiert, alles bleibt beim Alten.
Im Vorfeld der päpstlichen Entscheidung hatte der konservativ-traditionale Flügel Druck ausgeübt. Einer davon war der afrikanische Kardinal Sarah, der in Buchform gegen die Aufhebung angeschrieben hatte in einem Buch. Als völlig überraschender Co-Autor war Benedikt genannt. Die Verwirrung war groß, und der alte Papst verwahrte sich gegen die angebliche Mitarbeit.
Der Kontakt nach Freiburg ist dünn
Die Spur führte zu Georg Gänswein, der das Büro des alten Papstes führte. Er stritt ab, doch liegt seine Urheberschaft offen. Der Vorwurf der mangelnden Loyalität stand und steht im Raum. Wenige Wochen später wurde er als Protokollchef „beurlaubt“. Der Privatsekretär war zum sehr privaten Sekretär degradiert worden.
Im Erzbistum Freiburg beobachtete man die Vorgänge immer genau. Seitdem offenkundig ist, dass Georg Gänswein zurück ins Badische kommt, macht sich ein klammes Gefühl breit. Es steht in der Zeitung, dass der prominente Mann kommt, doch Genaues weiß man auch im Ordinariat nicht.
Der berühmte Mann aus Rom sucht eine Bleibe, sucht Verwendung oder ein leeres Pfarrhaus. Und doch herrscht breite Unkenntnis. Auch das ist eine Seite der Chronik: Der Kontakt war nie sehr intensiv. Man ignoriert sich prominent.
Ein Hindernis für eine geräuschlose Rückkehr ist der Titel, den der Mann führt: Benedikt XVI. erhob seinen Adlatus noch zum Erzbischof dem Titel nach – über eine Diözese, die nur noch auf dem Papier steht. Damit wollte der damalige Papst seinem Vertrauten etwas Gutes tun. Für die Rückkehr ins Badische ist der pompöse Titel eher Bleigewicht als Schwimmkörper.
Ein Bischof für die Basis?
„Wir brauchen keinen „Gegenbischof“, denn der Freiburger Erzbischof heißt Stephan Burger“, sagt es etwa Bernhard Stahlberger, Pfarrer in Görwihl im Hotzenwald dem SÜDKURIER frei heraus. Der steile Titel verbaut die Integration. Gut gemeint, aber für das einfädeln ich die pastorale Basisarbeit hinderlich.
Auch ein anderer Geistlicher stellt die Praxis der ehrenhalber ernannten Bischöfe infrage: Weihbischof Paul Wehrle, der seinen (Un)Ruhestand in Liggeringen (Kreis Konstanz) verbringt. Er sagt auf Anfrage: „Das ist ein Beispiel für die Instrumentalisierung der Bischofsweihe. Diese dient als Anerkennung und zur Repräsentation.“
Eine echte Verantwortung für ein Bistum mit Gläubigen stecke nicht dahinter. Wehrle weiß, wovon er spricht: Er leitete für eine Zeit des Übergangs das Erzbistum Freiburg, bevor Robert Zollitsch gewählt wurde. Heute wirkt er als „bischöflicher Pfarrer“ auf dem Bodanrück – ohne Anspruch auf Sonderrechte. Könnte Georg Gänswein das auch – Seelsorge treiben auf dem Land?
Dabei mangelt es an kirchlichem Personal. „Überall fehlt es an Seelsorgerinnen und Seelsorgern“, schreibt der Theologe und Spiritual Peter Stengele (Stockach). Eigentlich braucht man jeden, denn: „Da würde sich in einem Seelsorgeteam doch eine Aufgabe finden lassen. Als Mitarbeiter versteht sich – und nicht als Bischof!“, ergänzt er.
Der Katholizismus der römischen Lesart, den Gänswein verkörpert, ist in Baden selten gewünscht. Bernhard Stahlberger sagt klar: „Rückwärtsgewandte Ansichten aus dem 19. Jahrhundert mit all dem kirchlichen Prunkbestreben sind jetzt total fehl am Platz.“