Die Attacken wurden heftiger. Irgendwann hielt es die Dreifachmutter nicht mehr aus. Letzte Konsequenz: Umzug ins Frauenhaus. Vor vier Wochen kommt sie zurück in die Wohnung. Sie will Kleidung holen. Ihr Ex-Freund wartet schon auf sie. Die Situation eskaliert. Er schlägt ihr mit einem harten Gegenstand auf den Hinterkopf. Die Frau ist sofort tot.
So hat es sich nach aktuellem Wissenstand Ende Mai in der Schramberger Straße in Villingen-Schwenningen abgespielt haben. Der Vater der Kinder sitzt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.
Aber wie geht es mit den Kindern weiter? Kommen sie ins Heim? Zur Oma? Zu den Paten? Und wer entscheidet eigentlich, anhand welcher Kriterien, was das Beste für die Kinder ist?
Bei der Stadt Konstanz: Markus Schubert. Der Abteilungsleiter für soziale Dienste des Jugendamts kennt diese Fälle. Sie kommen selten vor. Aber es gibt sie. Auch hier. „Wichtig ist, dass das Kind erstmal notversorgt wird. Es muss schließlich irgendwo unterkommen“, sagt er. Meistens bei den Großeltern, Paten oder einer anderen familiären Lösung.
Jugendamt muss Kinder jederzeit versorgen können
Wenn die nicht greifbar sind, denkt die Behörde um. Es muss per Gesetz immer in der Lage sein, Kinder zu versorgen. Jugendliche werden in einer Wohngruppe untergebracht.
Etwa bis zum zwölften Lebensjahr kommen Kinder aber in der Regel zur Bereitschaftspflege. Das sind erfahrene Eltern, die immer ein gemachtes Bett vorhalten. Notfall-Mütter, Akut-Väter quasi, die jederzeit traumatisierte Kinder pflegen. Sie sind in Rufbereitschaft, wie die 110. „Wir können nachts um drei anrufen und vorbeikommen. Immer. Ohne Ausnahme“, so Schubert.
Kinder dürfen keine Bindung zur Notfall-Mutter aufbauen
Wichtig: Der Aufenthalt muss kurz sein, damit keine Bindung zwischen Kind und Übergangseltern entsteht. Für das Jugendamt beginnt die „Clearing-Phase“. Also die Zeit, in der Schubert und Kollegen Akten wälzen, mit Angehörigen sprechen, miteinander diskutieren. Sie wägen ab, welche Lösung langfristig für das Kind am Besten ist.
„Wir streben einen familiären Weg an. In den meisten Fällen kommen sie zur Oma“, sagt Schubert. Aber die Voraussetzungen müssen passen. Und das wird geprüft. Wie fit – körperlich und geistig – sind die Großeltern? Gibt es genügend Wohnraum?
Was tun, wenn der Vater plötzlich vor der Tür steht?
Und: Wie gehen sie mit dem Loyalitätskonflikt um? Also beispielsweise der Situation, wenn der Vater aus Schwenningen frei käme. Irgendwann will er seine Kinder sehen. Aber Oma und Opa müssen unter Umständen hart bleiben und den Kontakt unterbinden. Können sie das wirklich aushalten?
Solche Fälle gibt es häufiger, als man denkt. Das Jugendamt Konstanz bekommt jährlich zwischen 80 bis 100 Meldungen zur Kindeswohlgefährdung aus der Bevölkerung und anderen Institutionen wie Polizei, Schulen oder Kitas. Auch in solchen Fällen kann aus Oma und Opa plötzlich wieder Mutter und Vater eines Jugendlichen werden.
„Bei einem Drittel der Meldungen gibt es Entwarnung, bei einem Drittel wird aufgrund von Überforderung der Eltern Hilfebedarf deutlich und bei einem Drittel liegt eine derart hohe Gefährdung vor, dass sofortiger Handlungsbedarf besteht.“, schätzt Schubert.
Wann immer eine Meldung beim Jugendamt eingeht, lassen Mitarbeiter ihre Stifte fallen. Denn Kindeswohlgefährdung hat oberste Piorität. Sie gehen ins „Ad-Hoc-Gespräch“, bündeln Vorwürfe, prüfen Erkenntnisse, telefonieren mit Kitas.
„Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht“, heißt es in Artikel 6 des Grundgesetzes. Doch wenn Leib und Leben in Gefahr sind, Kinder vernachlässigt, misshandelt, missbraucht werden, Eltern nicht in der Lage sind, die Gefährdung zu beenden und andere Maßnahmen erfolglos bleiben – dann verwandelt sich das Jugendamt in ein „Wächteramt“. Und Kinder können in Obhut des Staates genommen werden.
Eindeutige Szenarien sind selten. In den meisten Fällen fließen die Übergänge wie Farbe und Wasser auf Leinwand. Kindeswohlgefährdung ist nicht schwarz, nicht weiß – eher undefinierbares Grau.
Kriterien: Lebensgefahr und „förderliche Entwicklung“
Das Jugendamt hangelt sich deshalb am Gesetz entlang. Neben Gefahr für Leib und Leben ist die sogenannte „förderliche Entwicklungsperspektive“ ein wichtiges Kriterium dafür, ob Kinder bei der Familie bleiben sollten – oder eben nicht. Heißt: Hat das Kind in diesem konkreten Einzelfall wirklich die Möglichkeit sich positiv zu entwickeln?
Eine schwammige Formulierung, die es aber braucht. Denn alle Familien sind anders. Es gibt Schnittmengen, aber keine Gleichheit. Am Ende entscheiden Schubert und Kollegen oft im Plenum, ob sie die Reißleine ziehen müssen. Das Familiengericht überwacht den Prozess. Es greift ein, wenn sich keine einvernehmliche Lösung mit der Familie abzeichnet oder Eltern mit einer Entscheidung des Jugendamtes nicht einverstanden sind.
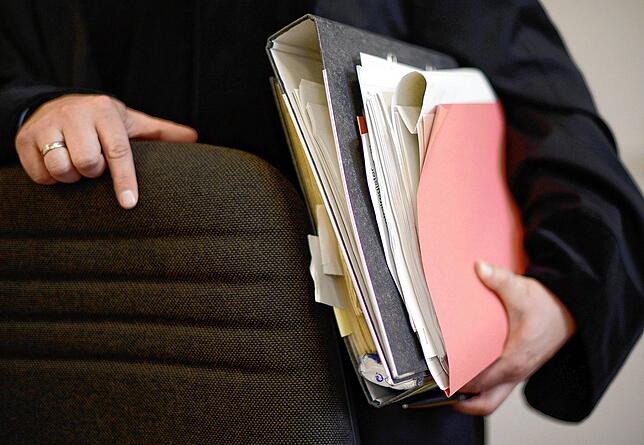
Kinder haben wenig Mitspracherecht
Das Kind selbst hat bei dieser Entscheidung bis zum 12. Lebensjahr nur wenig Mitspracherecht. Denn Kinder lieben ihre Eltern bedingungslos. „Sie wollen fast immer bei ihnen bleiben, auch wenn sie schwer misshandelt wurden“, schildert Ulrike Weißhaupt ihre Erfahrungen. Die Diplom-Psychologin leitet die psychosoziale Beratungsstelle, die zur Konstanzer Sozialverwaltung gehört. „Es muss manchmal jemanden geben, der eine gute Entscheidung für das Kind trifft, wenn es das aus Liebe selbst nicht kann – außerhalb der Familie“, sagt sie.
Damit es so weit nicht kommt, arbeitet Weißhaupt in erster Linie präventiv. Sie berät Menschen, die beruflich mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt stehen. Sie erklärt, wie man Kindeswohlgefährdung erkennt und richtig handelt. Lehrer, Ärzte, Fußballtrainer – alle können sich bei der psychosozialen Beratungsstelle melden. Sie schildern den Fall dann anonym.
Was tun, wenn ein Kind immer wieder blaue Flecken hat?
Ein fiktives Beispiel: Dem Sportlehrer fällt auf, dass der zehnjährige Maximilian viele blaue Flecken hat – und zwar nicht zum ersten Mal. Kommen die Verletzungen nun vom Rangeln mit Freunden? Ist er auf dem Heimweg von der Schule gestürzt? Oder ist der Vater wieder einmal ausgetickt?
Der Lehrer würde gerne helfen. Denn: Kinderschutz ist nicht allein Aufgabe des Jugendamtes. Es ist ein Auftrag an die Gesamtgesellschaft genau hinzusehen und wenn nötig Hilfe zu suchen – auch bei Ulrike Weißhaupt. Sie setzt sich mit dem Lehrer zusammen und berät im Sinne des Kinderschutzgesetzes.
Sollte sich im Beratungsprozess die Kindeswohlgefährdung erhärten, erfolgt eine Meldung an das Jugendamt durch die Person, die die Beratung in Anspruch genommen hat. Dann kommt Markus Schubert ins Spiel. Das Jugendamt ermittelt.
Jugendamt unterstützt Familie, um Trennung zu vermeiden
Dass aber Kinder aus Familien genommen werden, kommt selten vor. Es ist die Ultima Ratio, das letzte Mittel. In den meisten Fällen fungiert das Jugendamt als Unterstützer. Es bietet Erziehungsberatung, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand, Familienhilfe, sozialpädagogische Tagesgruppen, Vollzeitpflege, und, und, und an. Markus Schubert formuliert es so: „In der Öffentlichkeit sind wir häufig nur die, die den Familien die Kinder wegnehmen. Aber in 80 Prozent unserer Arbeit machen wir genau das Gegenteil – unterstützen.“










