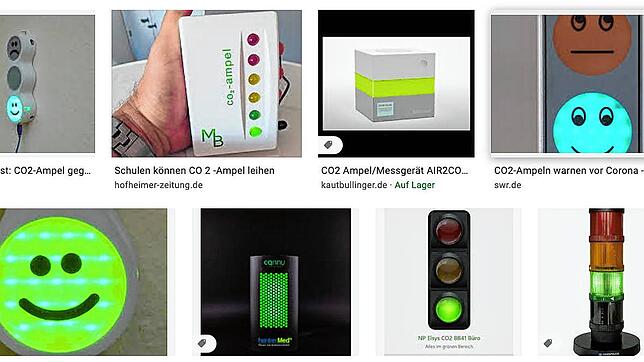Dass jetzt erst einmal Sommerferien sind, enthebt den Schulträger nicht der Aufgabe, schon das nächste Schuljahr ins Visier zu nehmen und Vorsorgemaßnahmen ins Auge zu fassen. Denn eine gewisse Höhe wird auch die ganz gemächlich anrollende nächste Pandemiewelle erreichen und schon jetzt wird der Präsenzunterricht im September thematisiert.
Vor diesem Hintergrund nützte Oberbürgermeister Jan Zeitler seine Berichte, um den zuständigen Fachbereichsleiter Raphael Wiedemer-Steidinger über die Vorhaben der Stadt zur Luftreinigung in den Klassenzimmern informieren zu lassen. Zumal derzeit viele ganz unterschiedliche Positionen zu dieser Problematik kursieren.
Raumlufttechnik wäre erst Ende 2022 einsatzbereit
Keine Notwendigkeit sehe die Verwaltung im Moment, neue fest installierte Raumlufttechnik(RLT)-Anlagen einbauen zu lassen, erklärte Wiedemer-Steidinger. Erst seit Juni 2021 seien zwar auch Neueinbauten für Räume mit Kindern bis zwölf Jahren förderfähig. Abgesehen davon, dass es ein Fragezeichen hinter der Kofinanzierung durch die Kommune gebe, wäre eine neue Anlage erst Ende 2022 einsatzbereit. Deshalb habe die Stadt aktuell kein Projekt geplant.
Keine Kriterien für „schwer belüftbare“ Räume
Noch Ungereimtheiten gebe es auch bei dem vom Land angekündigten Förderprogramm für mobile Luftreinigungsgeräte. Dies gelte nur für „schwer belüftbare“ Räume, wobei für dieses Attribut keinerlei Kriterien formuliert seien. Ohnehin seien derlei Geräte aus Sicht des Umweltbundesamtes nur von begrenztem Nutzen, berichtete Wiedemer-Steidinger. Zum einen führten sie keine Frischluft zu und ersetzten das Lüften nicht, zum anderen seien sie nur als Ergänzung sinnvoll.
Stadtverwaltung stützt sich auf Untersuchung
Ganz handfeste Argumente aus ersten praktischen Studien gebe inzwischen eine Untersuchung der Universität Stuttgart an die Hand. Als Fazit hält sie den flächendeckenden Einsatz mobiler Luftreinigungsgeräte aus mehreren Gründen für nicht angebracht. Alle getesteten Geräten verursachten Zuglufterscheinungen und hätten bei intensivem Betrieb eine hohe Lautstärke.
Dies werde von Schülern als massive Störung wahrgenommen, berichtete der Fachbereichsleiter aus der Studie. Zudem ersetzten die Geräte keineswegs Masken, Tests oder Abstandsregeln. Als „mittelfristiges Ideal“ nennt die Untersuchung allerdings doch die erwähnten RLT-Anlagen, die neben CO2 auch Feuchtigkeit abtransportierten, während die Wärme zurückgewonnen werde.
Nur in zwei Räumen kein Stoßlüften möglich
Stattdessen plädiert die Universitätsstudie für zwingendes Stoßlüften als schnellste und wirksamste Methode. Nach einer Umfrage bei den städtischen Schulen gebe es überhaupt nur zwei Unterrichtsräume, die nicht auf diese Weise über die Fenster gelüftet werden könnten.
Flankierend will die Stadt die Schulen mit so genannten CO2-Ampeln ausstatten und habe dazu eine Bedarfsabfrage gestartet. Die Ampeln zeigten durch mehrere Farbwechsel die Zunahme des CO2-Gehalts an und wann ein Luftaustausch dringend erforderlich ist. Bis zum Beginn der Heizperiode soll die Beschaffung abgeschlossen sein.