Nach dem Motto „Sorgen kann man teilen“ bietet die Telefonseelsorge Lörrach-Waldshut allen Menschen die Möglichkeit, per Telefonanruf über ihre Sorgen und Probleme zu reden. Am anderen Ende der Leitung sitzen Gesprächspartner, die speziell ausgebildet wurden. Seelsorgerinnen und Seelsorger haben ein offenes Ohr für ihre Anrufer. Ihnen wird damit eine besondere Aufgabe zuteil, die Fingerspitzengefühl und viel Empathie erfordert.
Anonym und vertraulich
Die Basis aller Gespräche bildet der Schutz der eigenen Persönlichkeit. Damit einher geht die Anonymität des Anrufers, aber auch die des ehrenamtlichen Seelsorgers. Tanja H. die sich ehrenamtlich in der Telefonseelsorge engagiert, heißt eigentlich anders. Die Redaktion hat sich entschieden, ihren echten Namen in diesem Bericht nicht zu nennen.
Wie wichtig ihre Aufgabe ist, daran besteht für Tanja H. kein Zweifel: „Die Telefonseelsorge ist für mich das perfekte Ehrenamt, da man Hoffnung auf Verbesserung säen kann.“ Über die Zeitung hatte sie vom Verein Telefonseelsorge Lörrach-Waldshut erfahren und Kontakt aufgenommen. Schnell stellte sich heraus, dass alles passt. Es folgte die sechsmonatige Ausbildung und „nun bin ich schon vier Jahre dabei“. Und das mit großer Freude, die im Gespräch deutlich wird, auch wenn die Themen der Anrufer meist alles andere als positiv sind.
Die Anrufe haben einen ernsten Hintergrund
Tanja H. wird konkreter: Seelsorge bedeutet, die Sorgen von anderen Menschen an sich heranzulassen und wirklich zuzuhören. Jeder Anrufer kann sich dabei seiner Anonymität immer sicher sein. Es werden keine Daten erhoben, Telefonnummern notiert oder gar Informationen weitergegeben.
Klar ist: „Die Menschen, die anrufen, haben Probleme, Sorgen, Nöte oder Ängste.“ Gründe gibt es viele. Chronische Schmerzen, Einsamkeit und Depressionen seien die Hauptgründe für die Anrufe bei der Telefonseelsorge. Es gebe Menschen, die weinend anrufen und kaum in der Lage seien zu sprechen. Andere wiederum seien gefasst und wüssten genau, was sie sagen und fragen wollen. „Es gibt welche, die einen anschreien, beschimpfen und aggressiv werden.“ Wie reagiert sie darauf? „Dann sage ich, dass ich so nicht mit ihnen telefonieren möchte.“

Letztlich bestehe die Aufgabe darin, zuzuhören und durch gezielte Fragen Möglichkeiten aufzuzeigen und die Hilfesuchenden positiv zu bestärken. Dass das mitunter eine große Herausforderung sein kann, wird klar an einigen Gesprächen, die Tanja H. beschreibt.
Hilfestellung in schwierigen Situationen
Vor kurzem habe sie einen jungen Mann am Telefon gehabt, dessen Mutter gestorben war. Er hatte extreme Mühe, das zu verarbeiten. Nach und nach habe er immer mehr Alkohol getrunken. Seine Freunde hätten ihn bereits gewarnt, doch er habe es nicht geglaubt, anfangs verharmlost. Dann sei er richtig abgerutscht in die Sucht. Als er erkannte, dass er ein Alkoholproblem hat, rief er bei der Telefonseelsorge an, mit dem Wunsch, das erste Mal überhaupt darüber zu sprechen.
„Es war im Nachhinein insofern ein gutes Gespräch, weil er keine Ahnung hatte, was für Hilfen möglich sind. Er ging zum Hausarzt, war bereit für eine stationäre Langzeittherapie. Er informierte seine Kollegen und seinen Arbeitgeber“, erzählt die Seelsorgerin. So habe er sein Problem lösen können.
Die schlimmsten Anrufe
„Mein schlimmstes Erlebnis war, als mal ein Mann anrief, der über eine von ihm durchgeführte Vergewaltigung berichtete. Das hat mich total geschockt. Mit diesem pädophilen Vergewaltiger zu sprechen, war für mich schrecklich. Da war ich dankbar, dass meine Kollegin den kannte“, erzählt die Seelsorgerin. Beide hätten den Fall dann mit in die Supervision genommen, um das Gehörte zu verarbeiten.
Ist hier eine Grenze der Telefonseelsorge erreicht? Zum Teil, denn im Team hätten manche den Grundsatz, nicht mit Pädophilen zu sprechen. Tanja aber hat die Haltung, dass sie mit so jemandem spricht, der so eine Neigung hat, als dass er in dem Moment irgendetwas plant. „Wenn man ihm schon eine Telefonnummer der Sexualberatung geben kann, ist das vielleicht schon ein erster Schritt.“
Schicksale wirken nach – wichtig ist der Umgang damit
Glücklicherweise sind nicht alle Themen so belastend und mit der Zeit bekommt der Seelsorger Routine. „An der Stimme und dem Atem kann man wahrnehmen, wie es der Anruferin oder dem Anrufer psychisch und physisch geht. Man hört, in was für einer emotionalen Verfassung jemand ist“, beschreibt Tanja H.
Oft entstehe bei den Gesprächen eine gewisse Nähe, die sich in dem Moment nicht ändern lässt. Bei der Telefonseelsorge rufen auch Menschen an, die manchmal sogar suizidal sind. Jedoch sollten Seelsorger dann zur professionellen Distanz zurückkehren, nicht persönlich oder wertend werden, berichtet sie. Mit der seelischen Belastung, die die Arbeit eines Seelsorgers mit sich bringen kann, geht dagegen jeder anders um. Tanja H. schreibt besonders schwere Gespräche in einem kleinen Buch auf. „So kann ich sie aus meinem Kopf wieder entlassen“, erzählt sie.
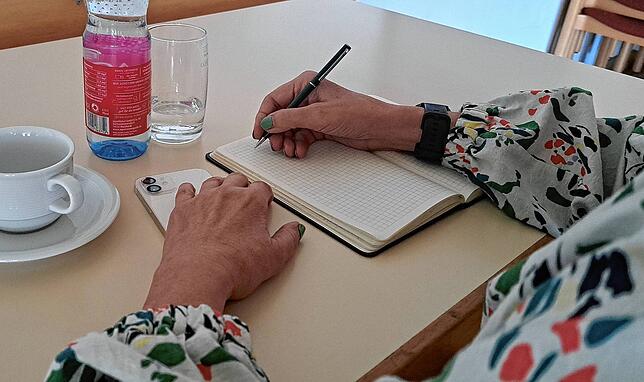
Jeder müsse auf sich selber achten, dass man ein gesundes und erfülltes Leben führen kann. Denn Geschichten und Schicksale wirken nach. Daher reden Seelsorger oft mit Kollegen oder in Gruppentreffen, der sogenannten Supervision. Das sei eine gute Möglichkeit, sich über belastende Telefonate auszutauschen und gebe Sicherheit. Tanja H. selbst kommt aus dem sozialen, therapeutischen Berufsfeld. Das hilft ihr, wie sie sagt.
Für Tanja H. steht fest: „Die vielen Erzählungen der Anrufer lassen einen eigene Probleme etwas relativieren und das eigene Leben wieder mehr schätzen lernen.“ Dafür pflegt sie zum Beispiel ihre Hobbys, läuft gern in der Natur, fährt Fahrrad, liest Romane, Biografien und geht ins Fitnessstudio. „Ein guter Ausgleich ist auch, Zeit mit meinem Mann, der Familie und Freunden zu verbringen.“







