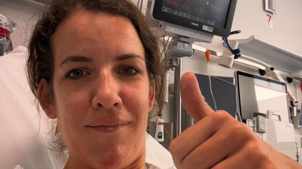Im Schnitt haben die Patienten von Palliativarzt Mario Steffens noch 21 Tage zu Leben. Er sagt: „Die Menschen, die wir begleiten, haben ihre Flügel noch nicht an, aber ihre Flügel liegen schon neben dem Bett.“ Der Tod sei schon mit im Raum, wenn der Mediziner eintritt. Und der Patient habe meist ein genaues Bild davon, wie viel Zeit ihm noch bleibt.
Eines kann man noch tun
Steffens ist der Geschäftsführer des noch recht jungen Palliativnetzes Lörrach, dessen Mitarbeiter totkranke Menschen zuhause begleitet, berät und mit Geräten sowie Medikamenten versorgt. Irgendwann komme der Moment, wenn der Klinik-Arzt sagt: „Wir können nichts mehr für Sie tun“ und den kranken Patienten nach Hause schickt. Zum Sterben. An diesem Punkt beginnt die Arbeit des Palliativnetzes. Denn:
„Es ist eine falsche Aussage, dass man nichts mehr tun kann, man kann immer noch eines: Die Lebensqualität erhalten. Und das ist unsere Kernaufgabe.“Mario Steffens
Ein weiteres Ziel sei es, die erneute Einweisung ins Krankenhaus zu vermeiden, damit die Menschen zuhause sterben können.
Dafür sorgen sieben Ärzte sowie fünf Pflegekräfte der gemeinnützigen GmbH im gesamten Landkreis Lörrach bis nach Müllheim, in Teilen des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald sowie in Wehr, der drittgrößten Stadt im Landkreis Waldshut. Seit dem Start des Palliativnetzes Lörrach im Februar 2019 wurden 320 Patienten zuhause versorgt.
Zwei bis drei Mal am Tag werden die Patienten besucht – 24 Stunden an sieben Tagen sind die Ärzte und Pflegekräfte erreichbar. Sie versorgen die Sterbenden mit Medikamenten, stellen Rezepte aus, führen individuelle Schmerztherapien durch und organisieren auch teuere Geräte wie etwa Pumpensysteme. Eine Arbeit, die auch die Hauärzte entlasten, so Steffens.

Das Palliativnetz ergänzt bestehende Hilfesysteme, zum Beispiel Pflegedienste, Hausärzte oder die ehrenamtliche Hospizbegleitung. So können häufig auch schwere körperliche und seelische Herausforderungen zu Hause bewältigt werden. Die Mitarbeiter des Palliativnetzes arbeiten dabei jedoch eng mit den Haus- und Fachärzten zusammen.
Im Vordergrund steht der Wille des sterbenden Menschen
Immer wieder fällt im Gespräch mit Steffens, der eine Praxis für Allgemeinmedizin in Weil-Friedlingen betreibt, das Wort „Lebensqualität“ – dem Schlüssel der Arbeit der Palliativmediziner.
„Sind erst einmal die Schmerzen gelindert, geht es dem Patienten besser und seine Lebensqualität steigt.“Mario Steffens
Es werde alles dafür getan, die Leiden zu lindern und die Handlungsfähigkeit des Menschen möglichst lange zu bewahren. Die sterbenden Menschen sollen in der Gesellschaft bleiben können. Im Vordergrund der Arbeit der Palliativmediziner stehe immer der Wille des sterbenden Menschen.

Steffens betont, dass sich das Palliativnetz ausdrücklich von aktiver Sterbehilfe distanziert, denn es gehe eben darum, das Leben auch am Ende noch lebenswert zu machen.
Über Ängste reden und auf den Tod vorbereiten
Und es geht auch darum, den Menschen, der mit dem Leben kämpft, zu begleiten, Vertrauen aufzubauen, ihn zu beruhigen und mit ihm über seine Ängste zu sprechen. Doch kann man einen Menschen auf den Tod vorbereiten? Steffens sagt: Ja. „Wir können offen und ehrlich mit ihm darüber reden und auch darüber, was er noch kann“, so der Arzt.
„Wir können ihn nicht retten, aber beeinflussen, wie er stirbt.“Mario Steffens
Die Phasen des Sterbens seien für jeden Menschen unterschiedlich. Sie bestünden etwa aus dem Kämpfen, der Abwehr und dem Hadern mit dem Schicksal. Auch der Erwartungshorizont nehme ab und die Realität passe sich diesem an. So sei es für die Patienten oft beispielsweise nur noch wichtig, noch einmal etwas mit den Kindern zu erleben, aber ohne Beschwerden. Einen Tag Normalität leben, das mache nun die Lebensqualität aus, so Steffens. Und diesen Tag Normalität möchte das Palliativnetz gemeinsam mit weiteren Partnern den Patienten mit dem Wünschebus ermöglichen. Alles weitere zu diesem Projekt lesen Sie hier:
Die Mitarbeiter des Palliativnetzes nehmen sich für ihre Patienten viel Zeit, sind regelmäßig und zum Teil bis zu eineinhalb Stunden bei ihnen zuhause. Denn: Hier geht es um den Menschen. In seinen letzten Tagen.
Sterben als Teil des Lebens
Auch die Angehörigen werden in dieser Zeit unterstützt. Vielen falle es schwer, damit umzugehen oder darüber zu reden. Die Mitarbeiter des Palliativnetzes betrachten das Sterben als einen Teil des Lebens. Doch in der Gesellschaft siehe dies anders aus: „Das Thema Tod ist immer noch am Rand unserer Gesellschaft, ein Tabu-Thema, weil es verdrängt wird“, sagt Steffens.
„Doch die Seifenblase des schillernden Lebens kann von heute auf morgen bei jedem platzen.“Mario Steffens