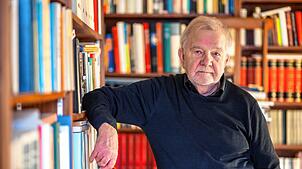Herr Frank, Sie sind nun gut vier Jahre Oberbürgermeister von Waldshut-Tiengen. Wie fällt Ihr persönliches Fazit zur Halbzeit aus?
Es war eine arbeitsreiche, aber auch lehrreiche Zeit, die geprägt war von großen Herausforderungen. Die größte war sicher das Spital. Ich war kaum drei Stunden im Amt, da galt es, aus dem Stand dreieinhalb oder sogar noch mehr Millionen Euro aufzubringen, um im kommenden Monat noch die Gehälter der damals 900 Beschäftigten in den beiden Häusern Waldshut und Bad Säckingen bezahlen zu können. Das traf mich völlig unvorbereitet.
Ich war somit – zusammen mit dem Landrat – vom ersten Tag an als Krisenmanager gefordert, um die Zahlungsunfähigkeit der Krankenhausgesellschaft abzuwenden. Denn der Klinikgeschäftsführer hatte ja bereits gekündigt und war nur noch wenige Wochen im Dienst. Ich denke, es gibt einfachere Umstände, so ein Amt anzutreten und in seine Aufgaben hineinzuwachsen. Das hat wirklich viel Kraft gekostet. Für den Einstieg war das eine Herkulesaufgabe.
Was war Ihr größter Erfolg, was Ihre größte Niederlage, was hat Sie ernüchtert?
So traurig es ist, aber der größte Erfolg war ganz sicher, dass es uns gelungen ist, einen Infarkt der damaligen Spitäler Hochrhein GmbH abzuwenden – und dass wir aus dem Spitäler-Vertrag überhaupt herausgekommen sind, weil dieser bekanntlich keine Ausstiegsklausel enthielt. Mit Letzterem ist der Stadt buchstäblich die Quadratur des Kreises gelungen. Dass in diesem Zusammenhang ein Krankenhaus geschlossen werden musste, ist bitter und hat weh getan. Es war aber der einzig richtige Weg, auch noch aus heutiger Sicht.
Als größte Ernüchterung oder Enttäuschung würde ich bezeichnen, dass wir aufgrund der Spitäler-Problematik, vor allem was die exorbitante Belastung für die Stadt angeht, gezwungen waren, im Gemeinderat die Schließung eines von zwei Freibädern zu diskutieren und dies auch zu beschließen. Das hat keine Freude gemacht. Ohne das Spitäler-Thema wäre diese Diskussion eine andere gewesen.
Ein markantes Ereignis war wohl der Bürgerentscheid zum Freibad Waldshut. Können Sie kurz skizzieren, wie weit die Planungen gediehen sind und wie die aktuelle Kostenschätzung aussieht? Wie teuer wird die Sanierung des Waldshuter Freibades tatsächlich?
Nach dem Bürgerentscheid haben wir eine Arbeitsgruppe eingerichtet, in der auch Pro Freibad mit drei Personen vertreten ist. Es hat eine europaweite Ausschreibung stattgefunden, die die Firma Hunziker für sich entschieden hat. Inzwischen liegen auch erste Zahlen vor. Ich bitte aber um Verständnis, dass ich diese an dieser Stelle noch nicht öffentlich machen kann, weil der Gemeinderat hier ein Erstinformationsrecht hat.
Sie haben im Frühsommer den Einzug in den Waldshuter Kreistag verpasst. Haben Sie diese Niederlage inzwischen verkraftet?
Verkraftet ja, aber es war schon eine herbe Enttäuschung für mich. Gerne hätte ich die Interessen der Großen Kreisstadt auch im Kreistag vertreten und die Entwicklung des Landkreises dort mitgestaltet. Immerhin sind wir größter Kreisumlagezahler.
Wann kommt das von vielen geforderte dritte Parkhaus in Waldshut?
Dann, wenn der Gemeinderat dessen Bau beschlossen hätte – als eine von mehreren Maßnahmen zur Entspannung der Parkraumproblematik in Waldshut. Hier verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, in dem ein möglicherweise weiteres Parkhaus ein Baustein ist. Vorab wollen wir Antworten auf Fragen wie: Ist das Parkverhalten änderbar? Wie können wir den Individualverkehr beeinflussen? Können wir die Menschen zum Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel bewegen? Anfang nächsten Jahres wollen wir hier einen Vorschlag unterbreiten, aus dem sich kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen ableiten lassen – unter anderem der Bau eines weiteren Parkhauses.
Die Sanierung der Kolpingbrücke in Waldshut dauert deutlich länger als geplant. Die Gründe dafür sind bekannt. Aber wäre es ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht besser gewesen, einen realistischeren Zeitpunkt für das Ende der Baumaßnahme zu kommunizieren, als immer wieder neue Daten zu nennen?
Im Nachhinein ist man immer schlauer. Diese Sanierung ist einfach ein hoch anspruchsvolles Projekt, bei dem wir uns immer wieder mit neuen unerwarteten Sachverhalten konfrontiert sahen. Dieser Macht des Faktischen hatten wir uns zu stellen. Aber ja, es wäre schön gewesen, wenn wir eine Punktlandung hinbekommen hätten.
Aus den Reihen des Gemeinderats wird moniert, dass zu viele Entscheidungen nicht öffentlich getroffen werden. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf?
Ich sehe das nicht als Vorwurf, sondern als Einschätzung einzelner Stadträte, die aktuell vom Regierungspräsidium geprüft wird. Wir hoffen, dass wir danach Sicherheit haben. Ich gehe davon aus, dass wir uns bislang nichts haben zuschulden kommen lassen. Grundsätzlich gehen wir genauso vor wie in den vergangenen 24 Jahren vor meinem Amtsantritt. Die Diskussionen um das Spital waren ein Sonderfall.
Die Gemeinderatswahl im Mai dieses Jahres war eine Zäsur. Von 26 Stadträten sind 16 neu. Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit mit dem neuen Gremium? Wie oft haben Sie sich schon den vorherigen Gemeinderat zurückgewünscht?
Grundsätzlich schaue ich gerne nach vorne, und überhaupt bin ich mehr ein positiv denkender Mensch. Wir haben jetzt einen jüngeren Gemeinderat mit viel frischem Wind. Zweifelsohne ist mit dem Weggang vieler altgedienter Stadträte aber auch viel Wissen verloren gegangen. Darum ist es wichtig, dass hier möglichst schnell alle auf den gleichen Kenntnisstand kommen. Im Frühherbst hatten wir schon mal eine zweitägige Klausurtagung, bei der wir die Stadträtinnen und Stadträte mit dem aktuellen Arbeitsprogramm der Verwaltung vertraut gemacht haben.
Was halten Sie von der von Harald Würtenberger initiierten Debatte um ein Zentral-Rathaus? Braucht die Stadt ein zentrales Verwaltungsgebäude und wenn ja, wo könnte es stehen?
Vom Grundsatz her finde ich diesen Gedanken gut, weil auch ich der Überzeugung bin, dass es viele Vorteile hätte, wenn die Verwaltung an einem Ort unter einem Dach zusammenarbeiten würde. Wenn man diese Diskussion führt, muss man aber auch sagen, wie man so ein Vorhaben finanzieren möchte. Und das sehe ich bei unserer schwierigen Haushaltslage in den nächsten zehn Jahren nicht als möglich an. So lange an den städtischen Gebäuden einfach nichts mehr zu tun, geht aber auch nicht. Denn wir müssen bei den Themen Brandschutz und Barrierefreiheit schon aus gesetzlichen Gründen handeln. Kurzum: In der Theorie ein guter Gedanke, für die Praxis nicht zu Ende diskutiert.
Von außen betrachtet sieht es so aus, als ob in der Stadtverwaltung eine hohe Personalfluktuation herrscht. Mitunter wurde und wird dies auch Ihnen persönlich zugeschrieben. Teilen Sie diese Ansicht und wenn ja, woran liegt es?
Richtig ist, dass es in der Verwaltung in den letzten Jahren einige personelle Veränderungen gab – und dies aus ganz unterschiedlichen Gründen. Wir hatten etliche altersbedingte Abgänge, aber auch Abgänge, weil Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sich beruflich verbessern konnten oder sich bei uns nicht mehr wohl gefühlt haben. Dass das in einzelnen Fällen auch mit mir zu tun hatte, kann ich nicht ausschließen – in der Regel sagt einem das niemand direkt ins Gesicht. Entscheidend ist für mich am Ende aber, dass es uns gelungen ist, die frei gewordenen Stellen – meiner Meinung nach – stets wieder gut nachzubesetzen. Auf den Punkt gebracht: Ja, es gab Fluktuation. Dies ist bei 500 Beschäftigten aber etwas ganz Normales.
Was unternehmen Sie, um die ambulante medizinische Versorgung in Waldshut-Tiengen zu verbessern?
Statistisch gilt Waldshut-Tiengen als noch gut versorgt. Aber sicherlich würde auch ich mir die Versorgungslage hier und da besser wünschen, etwa im hausärztlichen, gynäkologischen oder auch HNO-Bereich. Als Stadt sind uns leider die Hände gebunden, um hierfür Geld in die Hand zu nehmen und Ärzte einzukaufen. Wir können nur bei den weichen Faktoren helfen, etwa der Kita-Platz- oder Wohnungssuche. Und das tun wir.
Würde einem Mittelzentrum nicht auch ein Ärztehaus gut zu Gesicht stehen?
Klar, gar keine Frage. Ich bin guter Dinge, dass wir das über kurz oder lang auch erleben werden. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass wir in Waldshut-Tiengen bereits zwei Ärztehäuser haben, in Waldshut und Tiengen.
Im Haushalt 2020 sind rund vier Millionen Euro Zuschuss für die Sanierung des Waldshuter Krankenhauses eingeplant. Wie viel bleibt nach Abzug der zu erwartetenden Zuschüsse tatsächlich an der Stadt hängen?
Das kann ich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beantworten. Das hängt von der Höhe der Zuschüsse ab, die hierfür beantragt sind. Im Idealfall aber weniger.
Wie viel Geld muss die Stadt nach 2020 noch an die Klinikum Hochrhein GmbH bezahlen?
Insgesamt stehen noch etwa zehn Millionen Euro aus, inklusive der oben erwähnten vier Millionen. Auch hier kann sich die Summe noch verringern, je nachdem, wie hoch die beim Land beantragten Zuschüsse ausfallen.
Sie haben auf dem Aarberg gebaut. Fühlen sie sich in der Bergstadt wohl?
Ja, wir – meine Frau, meine Söhne und ich – fühlen uns dort sehr wohl. Es ist dort sehr grün, ruhig und familiär. Außerdem ist es der ideale Standort für meine Funktion als Oberbürgermeister, denn ich bin sowohl schnell unten in Waldshut als auch drüben in Tien-gen. Es war die richtige Entscheidung, dorthin zu ziehen.
Wie weit sind die Überlegungen für ein weiteres Baugebiet auf dem Aarberg, also die „Bergstadt IV“?
Waldshut-Tiengen ist eine Stadt mit anhaltender Nachfrage nach Baugrund. Mit den Wohngebieten Am Kaltenbach, Homburg und Bodenäcker sind wir mit großflächigen Angeboten erst mal am Ende angelangt. Eine „Bergstadt IV“ könnte zum Thema werden, was aber sicher nicht schnell und einfach ausdiskutiert wäre. Denn so ein Vorhaben wäre mit weiterem Landschaftsverbrauch und nicht unerheblichen Folgekosten im Infrastrukturbereich verbunden, vor allem bei den Kitas und Schulen.
Wo könnte die Stadt sonst noch ein größeres, zusammenhängendes Baugebiet ausweisen?
Aktuell schauen wir in den Ortschaften, was dort noch erschlossen werden kann.
Soll Waldshut-Tiengen überhaupt noch im großen Stil wachsen?
Das ist eine Frage, mit der sich der Gemeinderat in der Tat zu befassen hat. Wollen, müssen wir unbedingt weiterwachsen? Und wenn ja, welchen Preis wären wir bereit, dafür zu bezahlen? Ein Baugebiet „Bergstadt IV“ wäre – wie gesagt – mit massiver Abholzung und der Suche nach Ausgleichsflächen verbunden. Von den infrastrukturellen Folgekosten ganz zu schweigen.
Gibt es noch freie Gewerbeflächen in der Stadt, auf denen sich auch größere Unternehmen ansiedeln könnten?
Ja, die gibt es, wir gehen bei deren Vergabe aber sehr konservativ vor. Schließlich handelt es sich bei den Gewerbeflächen um unsere rarste und damit kostbarste Ressource. Bei allen Anfragen haben wir stets auf dem Schirm: Handelt es sich um ein heimisches Unternehmen oder eine Neuansiedlung? Handelt es sich um eine Unternehmensfortführung oder eine Neugründung? Hat das Unternehmen Aussicht auf Wachstum und Zukunft? Wie viele Beschäftige hat das Unternehmen, heute und morgen? Rundet es unser Branchenportfolio ab und verhilft zu einem breiteren, krisenbeständigeren Branchenmix? All das gewichten wir, um zu einer Entscheidung zu kommen.
Was tun Sie als OB, um neue Unternehmen in die Stadt zu holen?
Grundsätzlich ist es mein Anspruch, über alle gewerblichen Themen im Bilde zu sein. Vieles erfahre ich auch bei meinen regelmäßigen Unternehmensbesuchen. Persönlich bin ich vor allem dort im Einsatz, wo Unternehmen erweitern wollen oder Gefahr besteht, dass sie abwandern. Bislang haben wir hier noch fast immer eine Lösung gefunden. Einige Male waren uns aber auch die Hände gebunden, weil wir kein angemessenes Flächenangebot machen konnten.
Was sind die schönen Seiten des Amts, was empfinden Sie als negativ?
Oberbürgermeister zu sein, ist ein recht privilegierter Job. Man kann nicht nur, wie bereits gesagt, etwas bewegen, sondern man gewinnt auch unglaublich viele Einblicke und kommt herum. Das finde ich spannend und schön. Weniger schön ist, dass das Amt mit einem hohen zeitlichen Aufwand und einem großen Verzicht auf Privatleben verbunden ist. Aber das wusste ich vorher, darum mag ich mich darüber nicht beklagen.
Was sind Ihre Visionen für die zweite Hälfte Ihrer Amtszeit? Wie soll Waldshut-Tiengen am Ende Ihrer ersten Amtszeit entwickelt haben?
Zunächst einmal ist mir wichtig, dass wir die begonnenen Projekte gut zum Abschluss bringen. Dazu gehören die Realisierung des neuen Feuerwehrgerätehauses Waldshut – mit Kita auf dem Dach –, die Sanierung des Kornhauses – mit der neuen Stadtbibliothek Waldshut –, die Sanierung unserer beiden Freibäder sowie die Ertüchtigung unserer Schulen und Betreuungseinrichtungen.
Was das Klettgau-Carreé angeht, das große Leuchtturmprojekt für Tiengen, hoffe ich, dass es uns gelingt, während der zweijährigen Bauzeit die Beeinträchtigungen für den Handel so gut als möglich zu kompensieren. In den kommenden Jahren werden wir es weiter mit dem Ausbau der Kinderbetreuung – hier gehen wir aktuell vom Bau mindestens einer weiteren Kita aus – und der weiteren Abarbeitung unseres städtebaulichen Sanierungsprogramms zu tun haben; ich denke dabei etwa an die Sanierung der Rheinstraße. Über ein weiteres Parkhaus sprachen wir schon.
Von den großen Themen wünsche ich mir, dass wir bei der A 98 den Durchbruch schaffen, durch die gemeinsame Erarbeitung einer konsensfähigen Vorzugsvariante. Und dass wir bei der Elektrifizierung der Hochrheinbahn – mit dem Haltepunkt Waldshut-West – den anvisierten Zeitplan halten. Überhaupt sind der Öffentliche Personennahverkehr und das Radwegenetz ganz große Themen für die nächsten Jahre.
Beabsichtigen sie, bei den OB-Wahlen in vier Jahren wieder anzutreten?
Ja, ich würde gerne eine weitere Amtszeit dranhängen. Meine Aufgabe als OB bereitet mir Freude, weil sie abwechslungsreich ist und viele Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Außerdem sind kommunale Projekte oft mittel- bis langfristiger Natur – da sind Kontinuität und manchmal auch langer Atem gefragt. Auch was das Private angeht, fühlen ich mich in Waldshut-Tiengen sehr wohl. Meine Familie und ich sind angekommen und hier zu Hause.