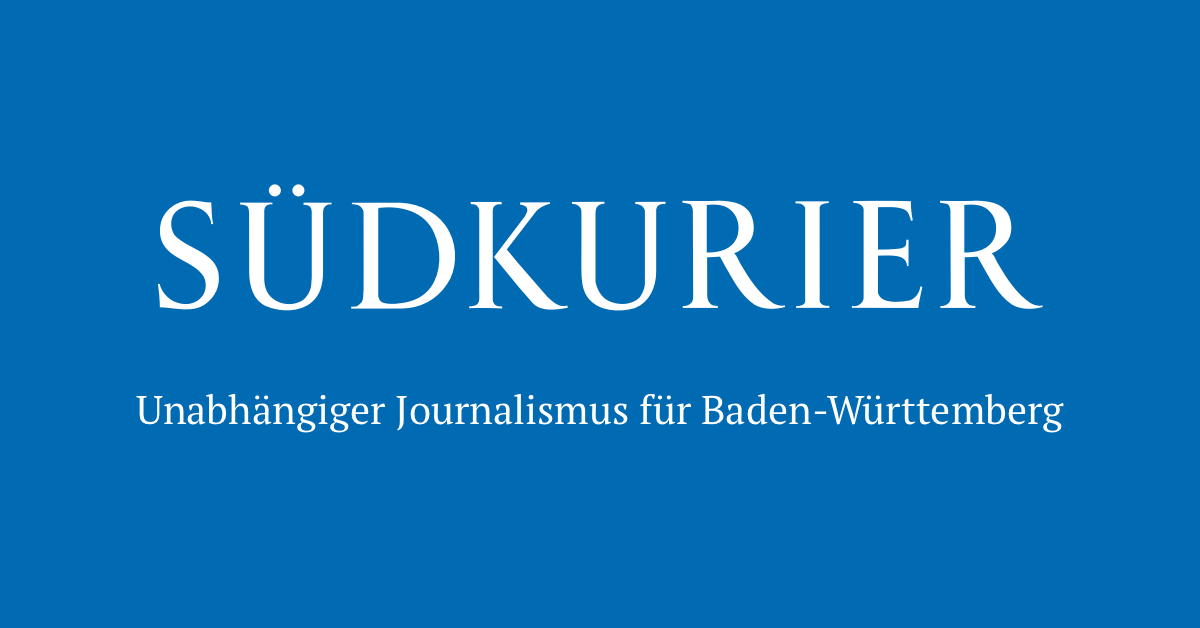Ein ehemaliger Anlagenoperateur des Schweizer Atomkraftwerks Leibstadt gegenüber von Waldshut ist an Krebs erkrankt, erhält aber keine Leistungen von der Unfallversicherung. Die oberste Gerichtsinstanz der Schweiz hat nun seine Beschwerde abgewiesen.
Die Arbeit
Die Diagnose folgte Jahre nach dem Ende der Anstellung in zwei Atomkraftwerken. Krebs stellten die Mediziner fest, Karzinome an Harnblase und Prostata. Im Sommer 2016 beantragte der erkrankte ehemalige AKW-Mitarbeiter Leistungen der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva). Die Krebserkrankung müsse als Berufskrankheit angesehen werden, argumentierte er. Eine Folge des strahlenbelasteten Umfelds in den beiden Betrieben, in denen er zeitweise gearbeitet hatte: Im AKW Leibstadt von 2003 bis 2004 als Anlagenoperateur, im AKW Mühleberg 2010 als Sachverständiger für den Schweizerischen Verein für technische Inspektionen.
Die erste Etappe
Die Suva lehnte den Antrag ab, das Zürcher Sozialversicherungsgericht bestätigte die Entscheidung. Daraufhin landete der Fall im März 2019 ein erstes Mal vor dem Bundesgericht. Vor der obersten Instanz erreichte der Mann zumindest einen Teilerfolg. Die Bundesrichter hoben die Entscheidung auf und verlangten ein klärendes Gutachten. Denn aus ihrer Sicht bestanden zumindest geringe Zweifel, ob die Krankheit nicht doch vorwiegend auf die Strahlenexposition während der Zeit in den Kraftwerken zurückzuführen sein könnte.
Die Rechtslage
Das Zürcher Sozialversicherungsgericht kam der Aufforderung nach und holte ein strahlenbiologisches Gutachten ein. Am Ergebnis änderte sich dadurch allerdings nichts: Anspruch auf Suva-Gelder bestehe nicht, befand die kantonale Instanz. Zum zweiten Mal wandte sich der Betroffene in der Folge ans Bundesgericht. Die zentrale Frage, die es dort zu klären galt: Handelt es sich bei der Krebserkrankung um eine Berufskrankheit? Nur wenn die Antwort Ja lautet, muss die Suva Leistungen erbringen. Berufskrankheiten liegen vor, wenn sie „bei der beruflichen Tätigkeit ausschließlich oder vorwiegend durch schädigende Stoffe oder bestimmte Arbeiten verursacht worden sind“. So steht es im Gesetz.
Das Gutachten
Aus dem Gutachten des Strahlenbiologen geht hervor: Ob ein Tumor durch Strahlung ausgelöst worden ist, lässt sich nicht mit Sicherheit nachweisen. Stattdessen kann nur berechnet werden, wie wahrscheinlich ein Zusammenhang erscheint. Und die sogenannte Verursachungswahrscheinlichkeit liegt im Fall des früheren AKW-Mitarbeiters deutlich unter 50 Prozent. Möglich wäre gar ein gegenteiliger Effekt, wie der Gutachter mit Verweis auf die weltweit bislang größte Studie mit Arbeitnehmern in der Nuklearindustrie feststellt: Für diese Art von Krebs würden die Ergebnisse eher auf einen Schutz durch die Strahlung als auf ein erhöhtes Risiko hindeuten.
Das Urteil
Mit seinen Einwänden konnte der frühere Anlagenoperateur die Bundesrichter nicht überzeugen. Unter anderem hatte er argumentiert, das gleichzeitige Auftreten eines Harnblasen- und Prostatakarzinoms sei extrem selten. Das Gutachten widerspricht dieser Annahme, je nach Studie komme diese Kombination in 27 bis 70 Prozent der vergleichbaren Fälle vor. Die obersten Richter stützen ihr Urteil auf die Einschätzung des Strahlenbiologen, „einen ausgewiesenen Experten“, wie sie ihn nennen. Der Beschwerdeführer zeige keine zwingenden Gründe auf, die es rechtfertigen könnten, vom Gutachten abzuweichen. Das Bundesgericht kommt zu dem Schluss, die Voraussetzungen für eine Berufskrankheit seien nicht erfüllt, und weist die Beschwerde ab. Der ehemalige AKW-Mitarbeiter erhält keine Gelder der Suva, stattdessen muss er die Gerichtskosten von 800 Franken bezahlen.