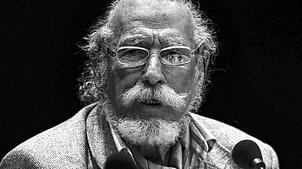Bei bestem Wetter und seichter See läuft die Fregatte „Medusa“ am 2. Juli des Jahres 1816 vor der afrikanischen Küste auf Grund. Doch was dann folgt, kann sich niemand an Bord auch nur im Entferntesten vorstellen. Der Bericht zweier Überlebender schockiert damals ganz Europa. Den französischen Künstler Théodore Géricault, der am Freitag vor 200 Jahren starb, inspirieren die Vorfälle zu einem der heute berühmtesten Gemälde der Welt „Das Floß der Medusa“.
Begonnen hat alles Anfang des Jahres 1816, als Hugues Duroy de Chaumareys das Kommando über ein Schiffsgeschwader mit symbolträchtigem Auftrag erhält. Vier Schiffe, angeführt vom ganzen Stolz der französischen Marine, dem Flaggschiff „Medusa“, sollen nach Saint-Louis in Senegal segeln, um die dortigen Kolonien offiziell im Namen Frankreichs von den Engländern zu übernehmen.
Nach dem Sturz Napoleons besetzt der aus dem Exil zurückgekehrte französische König nun im Zuge der Restauration alle wichtigen Positionen mit seinen Getreuen. Der Royalist Hugues Duroy de Chaumareys ist zwar der Nachfahre eines berühmten Admirals, doch er selbst hat sein letztes Schiff vor ganzen 25 Jahren kommandiert.
Als die vier Schiffe, „Medusa“, „Loire“, „Argus“ und „Echo“, am 17. Juni 1816 von Frankreich aus nach Senegal aufbrechen, fällt das Geschwader schon nach wenigen Tagen auseinander. Der Wundarzt Jean-Baptiste Henri Savigny und der Geograph Alexandre Corréard schreiben später in ihrem Augenzeugenbericht: „Am Golf von Gascogne verloren wir die ‚Loire‘ und die ‚Argus‘ aus den Augen, da diese unmöglich der schnellen ‚Medusa‘ folgen konnten.“
Lediglich die Korvette „Echo“ schafft es, hin und wieder zum Flaggschiff aufzuschließen. Als dann wenig später auch noch ein Schiffsjunge ins Meer fällt und ertrinkt, weil die Rettungsmaßnahmen nicht entschlossen genug durchgeführt werden, bekommen es die erfahrenen Seeleute an Bord mit der Angst zu tun, denn es gilt, äußerst gefährliche Gewässer zu durchfahren.
Es kommt zum offenen Streit zwischen den Offizieren und dem Kommodore, der aber keinerlei Kritik an seiner Handlungsweise zulässt. Ganz im Gegenteil sogar ernennt er den Passagier Antoine Richeford nun offiziell zum Vorgesetzten aller Dienstgrade, dessen Anordnungen unbedingt Folge zu leisten sei. Das Problem: Richeford hat selbst kaum nautische Erfahrung und führt die „Medusa“ offenen Auges in die Katastrophe.
Anstatt Kap Blanc, die letzte große Landmarke vor der gefährlichen Arguin-Sandbank, weiträumig zu umfahren, wählt Richeford einen Kurs nahe der afrikanischen Küste. Cornet de Venancourt, der Kapitän der „Echo“, will die „Medusa“ noch mit Signalen und Pulverschüssen auf die drohende Gefahr aufmerksam machen – aber vergebens.
An Bord der Fregatte versuchen indes die erfahrenen Offiziere zu retten, was noch zu retten ist. Eigenmächtig loten sie die Tiefe des Wassers mit einem Senkblei aus. Als der wachhabende Offizier den ahnungslosen Richeford warnt, die „Medusa“ steuere geradewegs auf eine Sandbank zu, winkt dieser überheblich ab. Richeford liegt wieder einmal falsch, obwohl Savigny und Corréard zufolge selbst die nautisch unerfahrenen Passagiere an Bord bemerken, dass das Wasser nicht mehr allzu tief sein kann: „Einige von ihnen meinten sogar schon den Meeresgrund zu erkennen.“
Auf Sandbank gestrandet
Schießlich passiert das, was viele der Seeleute lange befürchtet hatten: Die „Medusa“ läuft in nur fünfeinhalb Meter tiefem Wasser auf die Arguin-Sandbank auf. Alle an Bord sind entsetzt, Mannschaften und Passagiere verfluchen die Befehlshaber, Offiziere stellen De Chaumareys und Richeford zur Rede. Im Bericht an das Marineministerium heißt es später: „Das Unglück verbreitete die tiefste Bestürzung.“
Doch der eigentliche Schrecken beginnt erst, nachdem alle Versuche scheitern, das 46,9 Meter lange und 11,9 Meter breite Schiff wieder frei zu bekommen. Die „Echo“ hat die Gefahr nämlich inzwischen weiträumig umfahren und ist längst außer Sichtweite, und die „Medusa“ hat nicht einmal ansatzweise genügend Rettungsboote für alle der 400 Menschen an Bord. Der irrwitzige Plan der Kommandierenden: Die etwa 200 Personen, die nicht mehr in den Beibooten Platz finden, sollen auf einem eilig zusammengeschusterten riesigen Floß von den Booten bis nach Saint-Louis gezogen werden. Ob es Alternativen zu diesem Himmelfahrtskommando gegeben hätte, wird später Gegenstand eines Kriegsgerichtsprozesses sein.
Floß der Medusa
Am 5. Juli besteigen die Passagiere der Fregatte, unter ihnen der künftige Gouverneur von Senegal, Julien Schmaltz nebst Gattin und Tochter, hohe Offiziere und Beamte die Boote. Das Floß macht indes einen derart seeuntüchtigen Eindruck, dass viele der Schiffbrüchigen – vor allem Soldaten, denen man zuvor ihre Gewehre abnimmt, aber auch Handwerker und Seeleute – nur mit Waffengewalt hinauf gezwungen werden können. Über die etwa 20 Meter lange und 7 Meter breite haarsträubende Konstruktion aus einem Gewirr von Masten, Planken und Takelage schreiben die Überlebenden Savigny und Corréard später: „Die Menschen standen auf dem Floß bis zu den Hüften im Wasser.“
Obwohl erst 150 Personen auf das Floß evakuiert sind, stehen diese Savigny und Corréard zufolge schon so eng zusammen, dass „keiner auch nur einen einzigen Schritt hätte tun können“. Von den letzten 50 Mann bleiben 17 lieber auf dem Wrack der „Medusa“ zurück, als sich dieser lebensgefährlichen Konstruktion anzuvertrauen. Die anderen werden doch noch auf die Boote verteilt.
Aber selbst der Mut der Verzweiflung hilft den Schiffbrüchigen in dieser Situation nicht weiter und es passiert das, was passieren musste: Die Boote werden zum Spielball der Wellen und der Inkompetenz. Ein Seil nach dem anderen wird gekappt oder sogar absichtlich losgelassen. Auch dies ist eine Frage, der später der Kriegsgerichtsprozess nachgeht, bei dem De Chaumareys, der wie alle Bootsbesatzungen das Ufer erreicht, zu drei Jahren Festungshaft verurteilt wird.
Ohne Ruder, ohne Segel, ohne Hoffnung
Nachdem alle Seile gelöst sind und die Boote allein das Weite suchen, sind die 150 Menschen auf dem Floß, die bis zu den Hüften im Wasser stehen, sich selbst überlassen, und zwar fast gänzlich ohne Proviant, ohne Ruder, ohne Segel, vor allem aber ohne jede Hoffnung. „Nach Abfahrt der Boote war die Bestürzung unbeschreiblich“, erinnern sich die Überlebenden Savigny und Corréard später, die beide ebenfalls auf dem Floß der „Medusa“ um ihr Leben kämpfen.
Nach Stunden des Fluchens, Weinens und Betens nehmen sich die ersten das Leben und stürzen sich in die Fluten, andere verklemmen ihre Gliedmaßen derart schwer zwischen den zusammengebundenen Balken des Floßes, dass jede Hilfe zu spät kommt. Viele der Schiffbrüchigen sind verletzt, zum Teil schwer, alle dursten und hungern.
Die Verzweiflung ist bald so groß, dass einige der Soldaten beschließen, dem Leiden ein schnelles Ende zu bereiten, und mit Äxten und Messern beginnen, das Floß in Stücke zu hauen. Daraufhin entbrennt ein wilder Kampf zwischen denen, die mit ihrem Leben bereits abgeschlossen haben und jenen, die noch einen letzten Funken Hoffnung in sich tragen. Über Stunden hinweg fallen die Überlebenden immer wieder übereinander her, erstechen und erwürgen sich gegenseitig, werfen andere über Bord. In nur einer Nacht sterben über 60 Mann. Viele stürzen sich in auswegloser Situation selbst ins Meer.
Der Wundarzt Savigny und der Geograph Corréard, die wie durch ein Wunder dem Massaker entkommen, erinnern sich später in ihren Aufzeichnungen: „Nun waren wir noch achtundzwanzig. Aber nur fünfzehn von uns schienen ihr Leben noch ein paar Tage fristen zu können.“ Das Trinkwasser an Bord ist zu der Zeit nahezu aufgebraucht und so fassen diejenigen, die kaum mehr bei Besinnung sind, einen schrecklichen Entschluss: Um ihr eigenes Leben zu retten, stoßen sie die dreizehn Sterbenden ins Meer. Ganze sechs Tage später entdeckt die Brigg „Argus“ das Floß der „Medusa“ auf dem offenen Ozean. Die fünfzehn Männer an Bord sind mehr tot als lebendig, Leichenteile, von denen sie sich ernährt haben, liegen verstreut umher. Ein Schreckensbild sondergleichen.
Der französische Künstler Théodore Géricault hält später genau diese Szene in einem der heute berühmtesten Bilder der Welt fest. Sein Gemälde „Das Floß der Medusa“ von 1819 sowie auch der Augenzeugenbericht der überlebenden Savigny und Corréard, den diese für das französische Marineministerum verfassen, und der später veröffentlicht wird, schockieren damals ganz Europa. Bis heute gelten sie der Nachwelt als eindrucksvolle Warnung, wie schnell unsere Zivilisation doch Schiffbruch erleiden kann.