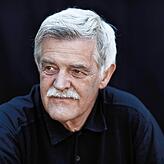So still wie diesmal wollten wir die stille Nacht nie haben. Mit dem Slogan „Ohne Kultur wird‘s still“ warnen Kulturschaffende vor den Folgen des Corona-Lockdowns, und auch Gastronomen und Hotelbetreiber können dem Wort „Stille“ kaum noch etwas Gutes abgewinnen. Müssen wir uns vor Stille fürchten?
„Fürchterlich und beglückend“
Nein, sagt der in Lindau lebende Komponist Nikolaus Brass. Aber die Angelegenheit sei ambivalent: „Für mich als Künstler ist ein Zustand der Stille ohne Termine und andere Ablenkungen fürchterlich und beglückend zugleich.“
Fürchterlich sei er wegen des fehlenden Austauschs, dem Mangel an Berührung und natürlich der weggebrochenen Einkünfte. Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass viele Künstler jetzt besonders produktiv sein könnten. „Stille öffnet einen Raum der Kreativität“, sagt Brass: „Sie ist für Komponisten ein Trägermedium wie für Maler die Leinwand.“
Ohne Stille kann es in der Musik keinen Anfang geben und kein Ende. Auch Differenzierungen der Lautstärke werden durch sie erst möglich: Jeder verklingende Ton ist ein Spiel mit der Stille, dieser akustischen Leinwand eines Komponisten. In der Musik kann Stille melancholisch wirken und dramatisch, traurig und sogar heiter.
Das Problem an der Stille ist: Ihre Wahrnehmung hängt vom Standpunkt ab. „Wer einen langen Arbeitstag hinter sich hat, braucht zur Entspannung vielleicht eher laute Musik als Stille“, sagt der Lärmforscher Michael Jäcker-Cüppers von der Technischen Universität Berlin. „Der Nachbar dagegen fühlt sich davon gestört.“
Lautes Meer stört nicht
Das Dilemma zeigt, warum es so schwierig ist, Lärm zu bekämpfen. Denn im Unterschied zur verbreiteten Meinung spielt die Lautstärke eines Geräuschs dabei nur eine Nebenrolle. „Die Meeresbrandung oder ein Wasserfall sind sehr laut, aber niemand käme auf die Idee, sich davon belästigt zu fühlen“, sagt Jäcker-Cüppers.
Bei Umfragen zu den Merkmalen von Sehnsuchtsorten der Ruhe lande ausgerechnet Vogelgezwitscher auf Platz eins: „Den meisten Menschen dürfte dabei kaum bewusst sein, wie laut dieses Geräusch eigentlich sein kann.“
Was Lärmbelästigung ist und was genussvolles Lauschen, das lässt sich nach Aussage des Experten nur annäherungsweise treffen. Grob gesagt: Natur ist angenehm, Technik nervt – Letzteres allerdings auch nur teilweise. „Ein von mir selbst erzeugtes technisches Geräusch stört lange nicht so sehr wie eines, das sich meinen Einflussmöglichkeiten entzieht.“
Wer etwa an einer Bahnstrecke wohnt und sich seit 20 Jahren vergeblich um Lärmminderung bemüht, dem gehen die vorbeirauschenden Züge immer mehr auf den Geist – auch dann, wenn ihre Lautstärke objektiv betrachtet gar nicht zugenommen hat. Das Gefühl der Ohnmacht verstärkt die empfundene Beeinträchtigung.
Und diese Ohnmacht ist lebensbedrohlich. Herzinfarkte, Schlaganfälle, Depressionen: Man muss nicht einmal nachts wach liegen, um gesundheitliche Schäden davonzutragen. Der Körper reagiert auf Geräusche auch unbemerkt.
Deshalb versuchen Politik und Behörden, seit Jahrzehnten dem Lärm Herr zu werden. Mit gemischtem Erfolg. Einerseits, erklärt Jäcker-Cüppers, hätten Autohersteller die Antriebs- und Rollgeräusche ihrer Fahrzeuge reduziert. An Fernstraßen wie an Eisenbahnstrecken sei es durch die Lärmsanierungsprogramme des Bundes merklich ruhiger geworden. Und ab kommendem Jahr seien auch alte, laute Güterwagen auf unseren Gleisen verboten.
Gelächter raubt Schlaf
Andererseits: Das Verkehrsaufkommen selbst nimmt weiter zu, früher unbekannte Geräte wie Laubbläser oder Hochdruckreiniger breiten sich aus. „Der technologische Fortschritt reduziert Lärm, bringt aber auch neue Geräuschquellen hervor.“ Und dann gibt es da auch noch die Veränderungen im Freizeitverhalten: Mit dem Klimawandel werden die Außenbereiche der Gastronomie attraktiver. Vor allem feuchtfröhliches Gelächter zu später Stunde, sagt der Lärmforscher, könne Anwohnern den Schlaf rauben.
Der Kampf um die Stille befördert die Bruchstellen unseres Gesellschaftssystems zutage. Das gilt zum Beispiel für die Geräuschverdichtung in visuellen Medien. Ein „Tatort“ aus den 80er-Jahren wirkt wie ein Stummfilm angesichts der Klangkulisse heutiger Spielfilme. Aufmerksamkeit ist in der Marktwirtschaft ein hohes Gut, je schärfer die Konkurrenz, umso größer die Versuchung, den Regler hochzudrehen.
Wir wollen den Geräusche-Kick
Doch wir Rezipienten sind nicht Opfer dieser Entwicklung, sondern verlangen selbst nach dem ständigen Geräusche-Kick. Die Wurzeln dafür reichen nach Ansicht von Nikolaus Brass bis in die Industrialisierung zurück, als die Menschen ihr Leben in Arbeits- und Freizeit aufteilten. „Den einen Teil unserer Zeit verkaufen wir jemandem, der andere gehört uns“, sagt der Komponist. „Umso mehr haben wir Angst, in unserer eigenen Zeit etwas zu verpassen. Wir drücken deshalb umso mehr Ereignisse hinein, damit uns bloß nicht langweilig wird.“ Dabei lasse sich doch an jedem Kind beobachten, dass Langeweile Kreativität hervorbringt: die Stille als Raum, in dem Neues entstehen kann.
Im Kapitalismus ist diese eigene Kreativität nicht gern gesehen. Statt sich selbst zu finden, soll der Mensch fremde Produkte konsumieren. Stille bedroht das Geschäftsmodell.

Auch der Traum von ewiger Jugend – größter Verkaufsschlager im kapitalistischen Konsum- und Verwertungssystem – verträgt keine Stille. Denn indem sie jeder Musik einen Anfang und ein Ende gibt, macht sie uns der Vergänglichkeit bewusst. Musik, sagt Brass, sei deshalb diejenige Kunst, „die uns am intensivsten begegnen lässt mit der Tatsache, dass alles einmal enden muss, jede Empfindung, jedes Glück, jede Trauer und jedes Leben“.
Wenn angesichts des coronabedingten Lockdowns über die gesellschaftliche und soziale Funktion von Kunst gestritten wird, so liegt für den Lindauer Komponisten genau darin ein wesentliches Argument: eine Gegenposition zu schaffen zur kapitalistischen Verwertungshaltung, Menschen zu sich zu bringen statt zu Verkäufern von Illusionen.
Und wie still ist nun die „stille Nacht“ am 24. Dezember? Die von Jäcker-Cüppers geleitete Fachgruppe „Arbeitsring Lärm“ hat es vor Jahren einmal in drei verschiedenen Städten untersucht. Das Ergebnis zeigte: Weihnachten könnte tatsächlich sehr still sein, kämen nicht immer wieder einzelne Geräusche dazwischen. In München waren es banale Bahnhofdurchsagen, die das Föhnwetter kilometerweit trug. Selbst in der stillsten aller Nächte findet sich immer etwas, das die Ruhe stört.