In fünf Minuten wird aus dem schlaksigen Mann ein Bestatter. Timon Zanger schlüpft in eine schwarze Hose, zieht ein graues Hemd an, darüber einen schwarzen Kurzmantel. Der junge Schreiner arbeitet in der Werkstatt von Ralf Homburger im Hilzinger Industriegebiet. Unter dem Dach des nüchternen Gewerbebaus stecken zwei Firmen: Im Erdgeschoss wird für behagliches Wohnen geschreinert, im Keller das letzte Gehäuse vorbereitet.
„Bestatter ist ein ehrwürdiger Beruf“, sagt Zanger und knöpft den Mantel zu. Deshalb hat er sich in den Totendienst als Zweitberuf eingearbeitet. Eine ehrwürdige Tätigkeit. Er steigt in einen schwarzen Mercedes Vito und fährt davon.
Die Bilder aus Sachsen waren unwürdig
„Respekt ist auch in Corona-Zeiten wichtig für uns“, sagt Ralf Homburger. Massentransporte zu den Krematorien? Nicht mit ihm. Der Sarg muss passen, die Feier soll würdig ablaufen. Würde. Die Fernsehbilder, die er über die Zustände im sächsischen Meißen sah, will er im Hegau nicht haben, das war würdelos.
Beisetzung erfordert aufwendige Vorkehrungen
Das Problem ist nur: Das Virus selbst ist unwürdig und heimtückisch. Es zersetzt die angestammten Rituale, den Händedruck, das Zusammenstehen. Die Beisetzung von Corona-Toten ist aufwendig und zwingt die Begleiter in unbequeme Kleidung, falls sie mit dem Toten in Berührung kommen.
Zanger und seine Kollegen sind dick vermummt, wenn sie einen Leichnam vorbereiten. Schutzbrille, Plastikanzug und Handschuhe, oft mehrere übereinander.
Die psychische Belastung ist groß
Das bedeutet Stress. „Ich bin ziemlich angespannt“, bekennt Homburger. Der Geschäftsmann ist ein quirliger Typ und dazu redegewandt. Und doch: Die Pandemie drückt aufs Gemüt des Bestatters. Sein Dienst steht am Ende eines tödlichen Krankheitsverlaufs.
Er muss den Angehörigen erklären, dass sie ihren Toten nicht mehr sehen dürfen, weil die offene Aufbahrung der Pandemieopfer verboten ist. Gestorben wird immer, doch selten war der letzte Gang so steril.
Der Tote ist ein Untoter
Was die Angehörigen nicht sehen: Der Leichnam wird in ein Tuch eingeschlagen, das desinfiziert ist. Es trieft von der Lösung. Dann kommt der Tote in einen Körpersack, der mit einem Reißverschluss luftdicht verschlossen wird. Schließlich könnte das Virus noch tagelang aktiv sein. Streng virologisch ist der Körper im Bodybag ein Untoter.
Homburger führt den Reporter durch die Unterwelt des Bestatters. Holzkreuze verschiedener Größen hängen an der Wand. Und einige Dutzend an Särgen, sie stammen vom Oberrhein, aus Italien, Österreich. Eine der Kisten ist bemalt. Kinder setzten mit kräftigen Strichen Blumen und Schnecken auf helles Holz. An Bügeln hängen frische Hemden, Berufskleidung für Zanger und seine Kollegen.
„Das ist ein Gang ins Trübe“
Zwei Bestattungen stehen an Tag an. „Mir hend mehr G‘schäft“, sagt Homburger. 2020 nahm er zehn Prozent mehr Aufträge entgegen. Auch wenn es gut für den Umsatz ist: So richtig wohl ist Homburger und seinen 15 Mitarbeitern nicht. Bei jedem Corona-Toten sind sie unmittelbar mit dem Virus konfrontiert. „Wir gehen doch in die Familien hinein und beraten sie. Das ist jedes Mal ein Gang ins Trübe.“
Was ihn wurmt: Es gibt noch keine Anzeichen, wann diese Berufsgruppe geimpft wird. „Wir sind bisher nicht in der Priorisierung“ – anders als Pflegekräfte oder Ärzte. Dabei sieht Homburger die Bestatter dicht an der pandemischen Front stehen, vergleichbar den Rettungsdiensten.
Es bleiben zwei Hände voll Staub
Noch dichter dran sind die Feuerbestatter. Das letzte Glied in der Kette des Lebens. Sie berühren den Toten nicht mehr. Doch verrichten sie einen Dienst, den alle zivilisierten Völker hoch ansetzen: Sie entziehen den Verstorbenen den Blicken und vertrauen ihn drei Elementen an: dem Feuer, der Erde, dem Wasser.
Dabei sind Krematorien ganz nüchterne Einrichtungen. Sie transformieren einen Körper innerhalb von einer guten Stunde zu zwei Händen voll Staub. Das ist zunächst ein technischer Vorgang, der mehr mit einem Heizkraftwerk als mit Gedenken zu tun hat. Wenigstens auf den ersten Blick.

Gedämpfter Ton, perfekte Technik
Ein Besuch im Schwenninger Krematorium, einem der modernsten im Südwesten, macht es deutlich. Dessen Betriebsleiter Roland Kleiser unternimmt vieles, damit Menschen in Würde gehen können. Neben seiner Begeisterung für gelungene Technik und die Verfeinerung von Abläufen spricht er gerne von der Würde dieses Haues. „Diese Haus ist ein Ort für kulturelle Zwecke“, sagt er.

Der Besucher sieht erst einmal wenig, wenn er die Führung im Krematorium der Stadt Villingen-Schwenningen beginnt: Der erste Kühlraum ist proper und leer, und den vollen zweiten Kühlraum mit 38 Särgen sperrt Kleiser nicht auf. „Sterben ist etwas Intimes“, sagt der Mann. Er will nicht, dass sich Holzkisten zum angenehmen Grusel stapeln. Neugier wird hier nicht gestillt, eher Nachdenklichkeit erzeugt. Die Bilder von überfrachteten Krematorien wie in Ostdeutschland liefert Schwenningen eben nicht.
Zur Weihnachtszeit fuhren sie Sonderschichten
Kleiser und seine Männer haben in der Corona-Zeit deutlich mehr Arbeit. Die Feuerbestatter spüren die Übersterblichkeit. Genaue Zahlen nennt der Chef nicht, „aus Konkurrenzgründen“, wie er umschreibt. Doch so viel: Mehr als 3000 Menschen fuhren im Jahr 2020 in die Glut. In gewöhnlichen Jahren sind es zwischen 2500 und 3000.

Die gestiegene Sterblichkeit fordert ihren Tribut. In den beiden Wochen vor und nach Weihnachten arbeiteten die sechs Männer auch samstags – ein Tag, der sonst frei war. Und werktags wurde die Schicht um eine Stunde verlängert. In der eleganten Anlage am Rande des Waldfriedhofs geht schon vor 5 Uhr das erste Licht an. Während es draußen noch dunkel ist, wird der Brenner früh angefahren und bis 22 Uhr bei 980 Grad gehalten. 17 Stunden lang feuert das Aggregat.

Vollbetrieb bei gedämpftem Tonfall
Konkurrenzgründe? „Dieses Krematorium ist auch ein Wirtschaftsbetrieb. Wir schreiben schwarze Zahlen, und das müssen wir auch.“ Die Stadt Villingen-Schwenningen baute es 2018, seitdem läuft es als Eigenbetrieb – verbunden mit der klaren Erwartung, dass keine Verluste entstehen.
Bei bis zu 17 Einäscherungen täglich ist kein Verzug möglich. Keine gemütlichen Kaffeerunden, kein Dudelradio in Endlosschleife, wie es aus vielen Büros tönt. Hier geht etwas, wenn jemand für immer geht. Und alles im gedämpften Tonfall.
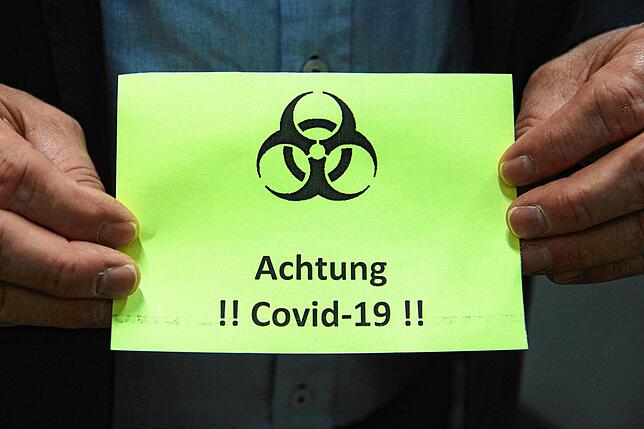
Das Räderwerk hier schnurrt auf hohem Niveau. Fast geräuschlos arbeitet die Gasfeuerung, die Elektronik summt, die Reinigungskraft tippelt auf Zehenspitzen hinter ihrem Gerätewagen her. Dessen bunte Putzeimer sind die einzigen Farbflecken. Sonst herrscht hier ein farbliches Nirwana: Grau, Anthrazit, Bernstein, Altweiß.
Immer mehr Menschen wünschen die Urne
Schwarze Zahlen garantieren, dass ein Krematorium weiterhin laufen kann. 486 Euro kostet eine Feuerbestattung an diesem Ort. Die Kremation liegt voll im Trend. Sieben von zehn Verstorbenen entscheiden sich mittlerweile für die Urne, Tendenz weiter steigend.
Für Roland Kleiser hat das konkrete Folgen. Das städtische Krematorium wird in Zukunft eine zweite Linie für Einäscherungen aufbauen, um die Nachfrage zu bedienen. Bereits jetzt fahren die schwarzen Autos mit dem hohen Buckel und den Milchglasscheiben aus fünf benachbarten Kreisen an. Schwenningen ist eine Adresse unter Bestattern. Diese haben jederzeit Schlüssel und Zugang für diese Einrichtung. Sie können nachts vorfahren und einen Sarg im Kühlraum deponieren.
Die Aschemühle mahlt fein wie Zucker
Ein Krematorium ist eine Mischung aus Hightech, flammenloser Hitze und leicht steriler Pietät. Für Angehörige steht ein Raum mit schweren Hockern bereit. Sie können zusehen, wie der Sarg in die Brennkammer einfährt. Nur wenige nehmen das wahr. Meist sind Kleiser und seine Männer unter sich.
Stunde um Stunde wird ein lebloser Körper in den Glutkasten geschoben, aus dem für Sekunden strahlende Hitze faucht, bis sich die Öffnung schließt. Dann durchläuft der Sarg verschiedene Stadien. Vier Stunden später rieseln die Reste drei Meter tiefer in den Aschekasten. In einer Aschemühle werden letzte Knochenstücke kleingemahlen. Fein wie Zucker.

Und wie hält er es mit dem Tod und was danach geschieht? „Das werden einmal meine Kinder entscheiden, nicht ich“, sagt Roland Kleiser.












