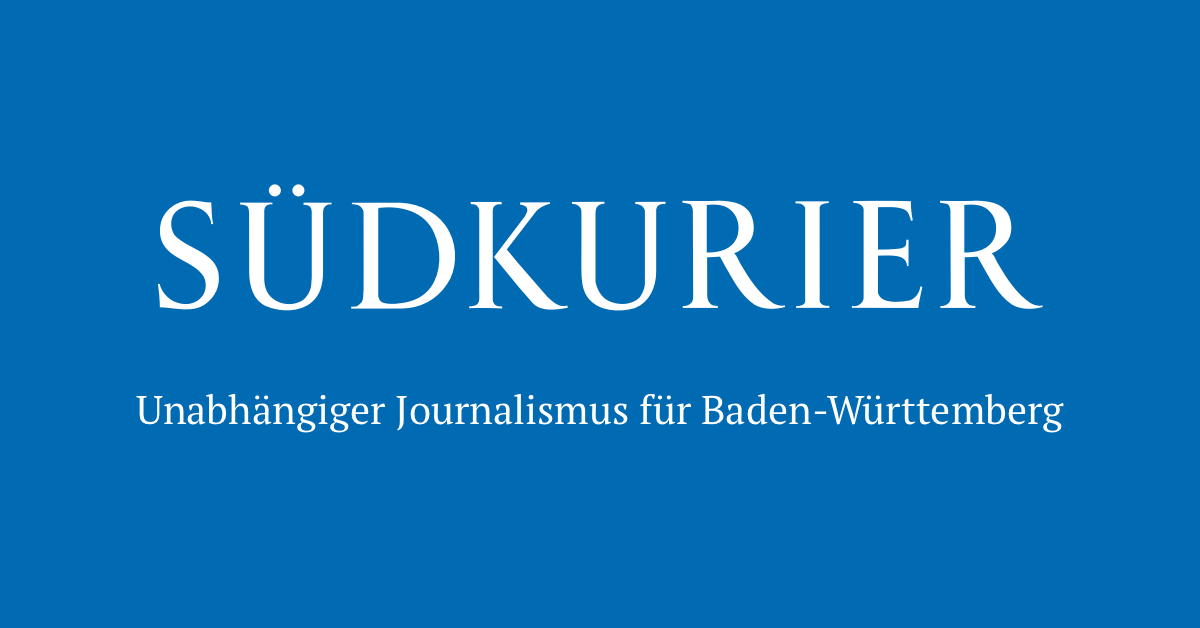Der andauernde Streit um die Züricher Flugverkehrsbelastung für Südbaden wurde für den Schwarzwald-Baar-Kreis besonders am Ende der 90er Jahre relevant, als man sich in Europa daran machte, die großen Flugrouten neu zu ordnen. Unversehens fand sich der Landkreis in der Züricher Anflugschneise wieder – inklusive des Luftwarteraums Rilax über Donaueschingen für Flugzeuge, die auf ihre Landeerlaubnis in Zürich warten müssen.
Die Politik zeigt sich bislang unfähig, diesen Konflikt dauerhaft zu lösen. Wobei es an ernsthaften Versuchen nicht mangelte. Immer wieder gab es Anläufe der Politik bis auf allerhöchsten Ebenen, eine Lösung herbeizuführen, aber alle scheiterten bislang. Selbst zwei fertig verhandelte Staatsverträge wurden nie rechtskräftig. Und das Problem schwelt weiter.
Nun gibt es einen neuen Versuch aus der Region heraus, die verhärteten Fronten aufzubrechen. Die Landräte Frank Hämmerle (Konstanz), Sven Hinterseh (Schwarzwald-Baar-Kreis) und Martin Kistler (Waldshut) haben mit Hohentengens Bürgermeister Martin Benz vorgeschlagen, auf zwei Mediatoren (also externe Vermittler in einem Streitfall) zu setzen– einer aus der Schweiz, einer aus Deutschland.
Anlass für diesen Vorstoß ist die jetzt vom Schweizer Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) erteilte Teilgenehmigung für ein verändertes Betriebsreglement für den Züricher Flughafen (siehe Infokasten). Einmal mehr betroffen von den aktuell geplanten Änderungen des Anflug- und Abflugreglements des Züricher Flughafens wäre die deutsche Seite, da die Starts von der Piste 32 in Richtung Norden erfolgen würde.
Martin Kistler wehrt sich mit seinen Landratskollegen gegen Teillösungen. Kistler: „Wir wollen eine einvernehmliche Gesamtlösung, kleine Schritte sind nicht hilfreich.“ Auch deshalb werde zugleich eine Klage gegen die Teilgenehmigung geprüft. Im Raum steht nicht zuletzt das geplante Wachstum des Flughafens auf 350 000 Flugbewegungen im Jahr. Ungeachtet möglicher juristischer Schritte wollen die drei Landräte aber eine von beiden Seiten getragene Lösung. Dass dies möglich ist, davon ist Landrat Kistler überzeugt: „Ich glaube, dass man es lösen kann, wenn sich beide Seiten bewegen.“ Eine Einigungsnotwendigkeit sei da, „auch in der Schweiz“. Zudem pflege man gute Freundschaften über die Grenze hinweg.
Ziel müsse der Anlauf für einen dritten Staatsvertrag sein. Dieser soll zum einen belastbare Ruhezeiten festschreiben und zum anderen dem Flughafen Raum für Entwicklung einräumen. Dazu sollen zwei Mediatoren eingesetzt werden. Martin Kistler schweben dabei Vermittler vor, die nachweislich „über Standing verfügen“, gestandene Persönlichkeiten also. Der Mediationsprozess vom Bund müsse vom Bund angestoßen werden müsse, so der stellvertretende Landrat in Waldshut, Jörg Gantzer. Aber es sei auch klar, dass die Region zwingend gleichberechtigt mit am Verhandlungstisch sitzen müsse. Und zwar mit den kommunalen Vertretern und den Vertretern der Bürgerinitiativen. Dass am Ende nur ein Kompromiss stehen kann, ist den Initiatoren des Mediatoren-Modells klar.
Schweizer Pläne
Das Schweizer Bundesamt für die Zivilluftfahrt (BAZL) hat dem Flughafen Zürich eine Genehmigung erteilt, einen Teil der schon seit 2014 angestrebten Neuordnung der An- und Abflugregeln umzusetzen. Demnach dürfen schwere, vierstrahlige Langstreckenflugzeuge künftig nach dem Start von der nach Deutschland ausgerichteten Piste 32 in geringerer Höhe als bisher erlaubt weiterfliegen. Außerdem sollen nächtliche Flugrouten zum Teil anders geführt werden. Offiziell sind diese Maßnahmen rein innerschweizerisch umsetzbar. Aber dahinter steht aus Sicht der Landkreise Waldshut, Schwarzwald-Baar und Konstanz ein viel umfassenderer Schweizer Plan (Ostentflechtungskonzept), der auch deutlich in den deutschen Luftraum eingreifen würde. Die Landräte fürchten, dass die Schweiz von diesem Konzept nicht ablässt, das den Schwarzwald-Baar-Kreis wesentlich stärker belasten würden. Flugzeuge würden sowohl von Westen als auch von Osten und Süden her vor dem Landeanflug auf Zürich zunächst über einen Anflugpunkt über dem Schwarzwald-Baar-Kreis geleitet werden. Erst dann würden sie über den Kanton Schaffhausen in den Endanflug auf Zürich geleitet. Die Konsequenz wäre eine Mehrbelastung der süddeutschen Region von bis zu 10 000 Flugbewegungen im Jahr, warnen die Landräte.
Fluglärm-Streit und Lösungsversuche
Der Fluglärm-Streit beschäftigt die Politiker auf beiden Seiten der Grenze bereits seit Jahrzehnten.
- 1984: Landeanflüge auf Zürich über deutsches Gebiet nehmen zu. Das Bundesverkehrsministerium und das Schweizer Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) vereinbaren, die Züricher Flughafenpisten ausgewogener zu nutzen. Deutschland kündigt 2000 die Vereinbarung, weil sie von der Schweiz nicht eingehalten wurde.
- 1999: Bei einer Neuordnung des Luftraums wird ein neues Anflugverfahren samt Anflugwarteraum für Zürich über Donaueschingen etabliert.
- 2002: Deutschland und die Schweiz beschränken per Staatsvertrag die Zahl der Nord-Landeanflüge auf jährlich 100 000. Das Schweizer Parlament lehnt den Vertrag ab.
- 2001: Deutschland erlässt eine Rechtsverordnung (DVO) zur Nutzung deutschen Luftraums. Alle juristischen Schritte der Schweiz und der Flughafen AG dagegen scheitern.
- 2009: Die süddeutschen Landkreise, Kommunen und Mandatsträger fixieren die "Stuttgarter Erklärung", die die Landeanflüge über Süddeutschland auf maximal 80 000 festschreibt und Starts ausschließt.
- 2012: Berlin und Bern vereinbaren einen neuen Staatsvertrag, der Höhenbeschränkungen für Start- und Landeanflüge über deutschem Gebiet absenkt und keine jährliche Höchstzahl vorsieht. Das Schweizer Parlament stimmt zu. Dem Bundestag wird er nach Protesten nicht zur Ratifizierung vorgelegt. (mhe/jdr)