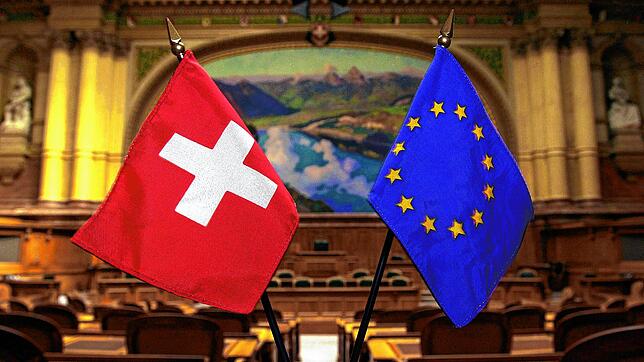1. Der Streit muss enden
Seit knapp zehn Jahren verhandelt die EU mit der Schweiz, um die Zusammenarbeit in einem neuen Rahmenvertrag zu bündeln. Das ist dringend nötig, weil die sogenannten Bilateralen Verträge I und II in der Schwebe stehen. Die Schweizer haben nämlich 2014 bei der Volksabstimmung „Gegen Masseneinwanderung“ auch Benachteiligungen für Gastarbeiter und Grenzgänger zugestimmt, die jedoch gegen die im EU-Binnenmarkt zentrale Personenfreizügigkeit verstoßen.
Bis heute ist es der Schweizer Regierung nicht gelungen, diesen Punkt so umzusetzen, dass die Bilateralen Verträge I damit nicht verletzt und folglich ganz aufgekündigt würden. 2021 brach die Schweiz die Verhandlungen für einen Rahmenvertrag schließlich einseitig ab, was vor allem innenpolitische Gründe hatte. Jetzt versuchen das Land und die EU, in diesem Jahr ein neues Paket auf den Weg zu bringen, um Streitfragen wie Lohnschutz und Personenfreizügigkeit zu klären.
2. Die Schweiz hat dazugelernt
Dass sich die Gespräche mit der EU über so lange Zeit erfolglos hinziehen, ist auch dem fehlenden Verständnis der Schweizer für das Europäische Recht geschuldet. So wurden die elementaren Grundfreiheiten des EU-Binnenmarktes (freier Verkehr von Gütern, Dienstleistungen, Kapital und Personen) von den Schweizern als politische Verhandlungsmasse betrachtet.
Und das, obwohl der Europäische Gerichtshof deren elementaren Stellenwert in seinen Urteilen immer wieder bekräftigt hat. Diese Freiheiten sind aber gerade der Punkt, den alle EU-Mitgliedstaaten ungeachtet aller Streitereien nie grundsätzlich infrage gestellt haben. Die Einsicht, dass daran nicht gerüttelt wird, hat sich nun auch in der Schweiz durchgesetzt.
3. Zusammen klappt‘s besser
Alleine der Wert der Güter, die 2022 zwischen der Schweiz und der EU gehandelt wurden, beläuft sich auf mehr als 330 Milliarden Euro. Das funktioniert aber nur, weil das Land, obwohl nicht in der Union, dennoch am Binnenmarkt teilnehmen darf. Das heißt auch, dass sich die Schweizer an dessen Regeln halten müssen.
Das macht sich aber durchaus positiv im Geldbeutel der Schweizer bemerkbar, wie eine Studie der Bertelsmann-Stiftung herausgefunden hat. Demnach ist das jährliche Pro-Kopf-Einkommen in der Schweiz durch die Teilnahme am EU-Binnenmarkt rund 2700 bis 3000 Euro höher, als es ohne die gemeinsamen Abkommen wäre. Und auch in anderen grenzübergreifenden Bereichen wie Verkehr oder Energieversorgung soll in Zukunft noch mehr zusammengearbeitet werden.
4. Die Wissenschaft leidet
Das schwierige Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU spürten zuletzt Studierende und Forscher sehr direkt. Vom fast 100 Milliarden schweren EU-Forschungsprogramm Horizon ist die Schweiz fast vollständig ausgeschlossen, was vor allem die stark vernetzten Schweizer Universitäten trifft.
Und auch vom Erasmus-Austauschprogramm hatten Schweizer Studierende zuletzt nichts mehr. Immerhin: Mit Beginn der nun anstehenden Verhandlungen will die EU der Schweiz eine Übergangslösung anbieten, was letztlich in beidseitigem Interesse ist.
5. Die Schweizer sind dafür
Dass nach der jahrelangen Hängepartie endlich Klarheit im Verhältnis zur EU einkehrt, wünscht sich auch die Mehrheit der Schweizer. In einer Umfrage des Instituts GFS Bern vom Dezember befürworteten 71 Prozent der Befragten eine Ausgestaltung der jetzt neu angestoßenen Abkommen. Nur die rechtsnationale Schweizerische Volkspartei (SVP) sprach in diesem Zusammenhang von einem „vergifteten Weihnachtsgeschenk“. Damit steht sie aber ziemlich alleine da.