Es war, als Richter Laaser noch lebte, den wir alle verehrten. Er war ein Mann, der mit den Angeklagten redete, als kenne er sie lange, aber sie ihn auch. Die Angeklagten hatten Vertrauen zu ihm, wir Anwälte waren immer froh, vor seinem Gericht zu stehen. Es war nie ein ungerechtes Urteil dabei.
Diesen Bosnier ließ ich einfach erzählen. Er war klein, hatte ein rundes Gesicht und war gerade erwachsen geworden, sodass Jugendrecht noch Anwendung fand. Der Fall hatte Schlagzeilen gemacht, die Tat war auf der Bahnhofstraße von vielen gesehen worden, und das Blut lag lange dort. Mein Mandant hatte ein Kebabmesser in einem Kiosk ergriffen, war aus nichtigem Grund auf einen Mitgast losgegangen und hatte dessen Gesicht zerschnitten. Es sah scheußlich aus.
In den Akten befanden sich dann diese Bilder, die alles erklärten, oder zumindest erklären konnten. Ein Sachverständiger beschrieb die Ausnahmesituation, in der sich mein Mandant befand, als er nach dem Messer griff und wutblind einen Fremden attackierte. Seine Steuerungsfähigkeit war schuldmindernd eingeschränkt. Das rettete uns die Bewährung. Natürlich entschuldigte es nichts. Und er wurde verurteilt. Aber zu einer Bewährung, die er nutzte und die ärztliche Hilfe, die ihm auferlegt wurde, verhalf tatsächlich zu einem Leben, in dem er, soviel ich weiß, nicht mehr straffällig wurde.
Dieses Bild in der Akte, das ich erwähnte, zeigte einen Kleiderhaufen, auf einer Brandstelle, umringt eigentlich von nichts als schwarzer Erde. Aus dem Kleiderhaufen in der Mitte stach eine rot karierte Jacke hervor, besser der große Fetzen, der von ihr übrig blieb.
Das Bild war im Balkankrieg aufgenommen, und so lange liegt die Geschichte auch zurück. Dieses Bild war dem jungen Mann an dem Tattag, am Morgen, zugespielt worden, kommentarlos, ohne Absicht. Er meinte sofort, die Jacke seines Vaters zu erkennen, der auf der Flucht zurückgeblieben war, mein Mandant selbst, die Geschwister und die Mutter waren im Bus nach Deutschland geflohen.
Die Mutter schweigt vor Gericht
Seit sechs Monaten hatten sie nichts vom Vater erfahren. Die Mutter schwieg, und ob sie es tatsächlich wusste, dass er dort ermordet und seine Jacke auf einen Haufen geworfen war, konnte nicht erfragt werden, sie schwieg sich aus, auch vor Gericht. Es war jenes Schweigen, das so manche Familiengeschichte durchdringt, das aus Gründen entsteht, die nicht mit Worten wiederholbar sind. Ihr war der Mund zugenäht wie meinem Mandanten die Seele.
Als er die Jacke seines Vaters in dem Haufen auf dem schwarzen Boden entdeckte, so berichtete er, habe er losschreien wollen, aber es nicht können, habe sich dann beruhigt und sei mit einem Freund losgezogen, durch diese friedliche Stadt, habe getrunken und gegen Abend war es in der Imbissbude zum Streit gekommen. Letztlich hatte sich alles in einem nichtigen Moment entzündet und in der Gewalt entladen. Es war ein warmer Abend.
Was ihn vor dem Streit verletzte, das erzählte er mir, war diese friedliche Stimmung in der Stadt, die warme Luft, die Spaziergänge, alles so weit von seinem Innern entfernt, dass er sich ganz und gar nicht mehr dieser Welt zugehörig empfand. Er allein trug solche Bilder im Kopf, und dort saßen die Menschen, die Passanten, die Touristen, saßen draußen in den Cafés, ohne eine Vorstellung von seinem Schmerz.
Ich erinnerte mich an meine Kindheit zurück, damals in den sechziger Jahren, im Aachbad, hatten wir noch ganz selbstverständlich auf diese Männer gesehen, denen ein Arm fehlte oder von den Knien abwärts ein Unterschenkel und der Fuß. Mein Nachbar damals, ein berühmter Singener Kunstmaler, war als Kind im Krieg verschüttet und schlief nur alle drei Tage, sonst lag er nachts immer wach. Er schrie manchmal. In einem Hinterhof der Harsenstraße wohnte ein Mann, dessen Namen ich nie wusste. Er zupfte immer mit zwei Fingern sich ein imaginäres Haar von der Zunge, auch wenn er mit andern sprach. Das hatte er aus dem Krieg mitgenommen.
Das Schweigen der Väter wurde durch diese Bilder umso lauter. Aber jeder konnte verstehen, was in den Köpfen der Verletzten vorging. In der Schule dann waren viele Mitschüler Kinder von Vertriebenen. Sie kamen aus Lagern, aber wir verstanden sie, und es musste nie viel erzählt werden.
Letztlich in diesem Bosnienkrieg, als die Flüchtlinge kamen, hatte sich etwas Entscheidendes verändert. Wir kannten deren Sprache, deren Ängste nicht. Wir konnten nicht mitfühlen, nicht aus den Gesichtern den Grad der Verzweiflung lesen und reagierten nicht auf die wehrlose, aufgestaute Wut.
Plötzlich standen Menschen aus anderen Welten neben uns, die sich nicht mitteilen konnten, die unsichtbare Sprache, die lautlose Sprache der Vertriebenen wurde nicht gehört. Das mag jetzt im Ukrainekrieg wieder so sein, die da kommen, werden von uns nicht gesehen. So bleiben sie im Kreis der Verletzten wie eingeschlossen zurück. Sie sind aus der Eingeschlossenheit geflohen und werden geschlossen bleiben, in einem freien Kreis fröhlicher Städte.
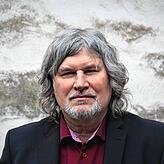
Der Verletzte in unserem Fall war ein nachsichtiger Mann, der sich die Entschuldigung meines Mandanten geduldig anhörte. Eine starke Narbe würde sein Gesicht für immer entstellen. Vielleicht ließ es sich operieren. Er berichtete als Zeuge von dem Augenblick, als sein Leben explodierte, als ein Mensch, wie wahnsinnig auf ihn losging und mit dem Messer sein Gesicht zerschnitt.
Er berichtete alles sachlich und nahm die Entschuldigung nicht an. Das war sein gutes Recht. Er schlief nicht eine Nacht durch, seit dieser Tat. Sein Leben war zerstört. Er hatte keinen Anlass geliefert, dass es sich so ereignete. Der Streit war aus dem Nichts entstanden.
Aber dieses Nichts war für den einen alles und wurde zur Katastrophe. Die Geschwister und Mutter meines Mandaten blieben im Gerichtssaal, bis das Urteil verkündet wurde. Sie waren erleichtert und weinten. Der Geschädigte war gleichsam im Gerichtssaal geblieben und schüttelte enttäuscht den Kopf. Auch ihn verstand ich.
Solchen Situationen begegnete ich als Anwalt oft: Es gibt keine Lösung, die jeden entschädigt, die jedem gerecht wird. Zu glauben, wenn etwas in Bosnien geschieht, wenn dort gemordet wird, es bei uns als Gewalt nicht ankommt, ist ein fataler Fehler gewesen. Die Sprache des Krieges nicht zu kennen und die der Opfer, kann uns niemand vorwerfen. Wie soll man das begreifen: In einem Kleiderhaufen das Bild seines Vater sehen und verstehen, dass er tot ist?
Gerechtigkeit setzt Wahrheit voraus
Das Opfer des Täters, den ich verteidigte, hatte aber am wenigsten Schuld daran. Er hatte ein Recht, dass sein Leiden durch die Strafe eine Genugtuung erfährt. Die Bewährung tat es für ihn nicht. Und Bewährung war für den Angeklagten angemessen, er würde es nie wieder tun, und war an diesem Tag nur außer sich. Aber gerecht war es für den einen, wie ungerecht für den andern.
Letztlich fragt sich immer wieder die Gerechtigkeit selbst, was Gerechtigkeit ist. Sie setzt Wahrheit voraus und soll zwischen Ursache und Folgen einen Ausgleich erzielen, der es uns ermöglicht, darüber zu sprechen und selbst zu urteilen. Es ist der Gerechtigkeit ein immanenter Widerspruch, dass wir ihr Ergebnis oft ungerecht empfinden. Aber gerade dadurch kommt es zum Ausgleich, zwischen Schuld und Entschuldigung, zwischen Erklärung und der Sprachlosigkeit.
Das paradoxe Argument, dass wir Menschen nicht alles beschreiben können, was wir verstehen, hilft, tatsächlich zu verstehen. Ja, wir müssen nicht in den Spiegel blicken, mit den Fingern die Narbe ertasten, dort, wo das Messer das Gesicht zerschnitten hat. Wir müssen nicht jede Nacht in Träumen das Blut abgewaschen, denn es wird nicht heilen. Und doch können wir begreifen, wie es zu einer solchen Tat gekommen ist.
Ich erinnere mich an einen Fall, der noch weiter zurückliegt. In einem Festzelt, ausgelassen und angetrunken, warf unser Mandant einen Bierkrug in die Luft. So hoch, so dumm. Er traf den Kopf eines fast Gleichaltrigen, der wurde schwer verletzt und konnte nie wieder gehen.
Das Urteil lautete auf bedingten Vorsatz, nicht auf Fahrlässigkeit, wie wir es wollten. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Aber, auch das begriff ich, ein Urteil kann nichts ändern und dort, nur dort, wo es im Innern das Schicksal verflucht, tröstet es nicht.






