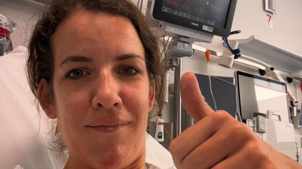Die Doppelstadt ist offenbar ein gutes Pflaster für kreative Köpfe. Erst kürzlich haben wir über Ingenieur Karl-Heinz Baumann berichtet, der für den Autobauer Daimler 250 teils bahnbrechende Patente im Bereich Fahrzeugsicherheit entwickelt hat und so das Autofahren für Millionen Menschen ein Stück sicherer machte.
Jetzt hat der SÜDKURIER Dieter Schaper getroffen, der ursprünglich zwar aus Sievershausen zwischen Hannover und Braunschweig stammt, nun aber bereits seit 22 Jahren in Villingen lebt. Auch er kann spannende Einblicke in die Entwicklung der Fahrzeugsicherheit während der vergangenen 40 Jahre geben, an der er, wie auch Baumann, nicht unerheblich beteiligt war.
- Karriere: Nach seinem Studium zum Diplom-Ingenieur an der TU Baunschweig heuerte Schaper 1974 bei Daimler Benz im Bereich Crash-Versuch an. „Ich hatte mir vorgenommen, meine erste Stelle nach zwei Jahren wieder zu verlassen“, so der Ingenieur. Konsequent wechselte er daher 1974 zur Adam Opel AG. Sein Nachfolger bei Daimler war übrigens Karl-Heinz Baumann. Elf Jahre blieb Schaper bei Opel, war in verschiedenen Bereichen wie Insassenschutzsysteme sowie Airbag und ein Jahr bei General Motors in Amerika tätig. Nach dieser Zeit wechselte er zur Firma Autoliv, ehemals Elektrolux-Autoliv, übernahm dort die Leitung der Produktentwicklung Deutschland. Wiederum elf Jahre später verschlug es ihn 1998 schließlich nach Villingen, wo er den Vorsitz der Geschäftsführung bei Mannesmann-VDO übernahm, ab 2000 bei Siemens VDO. Nach dieser Zeit folgten ab 2003 vier Jahre als Global Director beim Unternehmen Visteon. Heute ist er geschäftsführender Gesellschafter der KMCG GmbH, sucht und vermittelt qualifizierte Mitarbeiter und Führungskräfte für seine Kunden. „Das ist eigentlich genau das, was ich während meiner ganzen Laufbahn bereits gemacht habe“, so Schaper. „Gute und motivierte Mitstreiter finden, um gemeinsam Produkte neu zu denken, neu zu entwickeln oder zu verbessern.“ Ans Aufhören denkt der zweifache Familienvater längst noch nicht. Die Arbeit sei wie ein Jungbrunnen für ihn. „Mann muss sich immer auf Neues einlassen.“

- Sicherer Opel: „Bei Opel hatte ich enorme Freiheiten“, blickt Schaper zurück. Vieles sei so erst möglich geworden. Als Gruppenleiter Unfallforschung war er nicht nur in der hauseigenen Crash-Anlage zugange. In der Unfallforschung musste er Unfälle häufig auch vor analysieren, um so Crash-Folgen unter realen Bedingungen zu erfahren. Dabei habe man viel gelernt, was unter Laborbedingungen nicht sichtbar wurde. Schaper entwickelte in dieser Zeit zum Beispiel einen besseren Schutz vor Ladung für den Opel Caravan. „Bei ersten Crash-Versuchen mit Schreibmaschine, Bierkiste und Kühlschrank sind noch alle Gegenstände nach vorne durchgebrochen“, erinnert er sich. Am Ende, nachdem Schlösser und Scharniere verstärkt worden waren und Autobesitzer einen zusätzlichen Rahmen einschrauben konnten, war der Opel sicher. „Das von Daimler entwickelte Schutznetz wäre für unser Modell zu teuer gewesen“, erklärt er den Grund für die Eigenentwicklung. „Opel ist ein sehr sicheres Auto, auch heute noch“, da ist er sich sicher. Das Thema Airbags steckte damals noch in den Kinderschuhen. In gerade einmal einem Prozent aller Autos waren sie als Extra verbaut. Während seiner Zeit in Amerika beim Opel-Mutterkonzern General Motors konnte er erste Erfahrungen sammeln, denn dort war man bereits einen Schritt weiter.
- Kleine Airbags: Mit diesem Wissensschatz im Gepäck heuerte Schaper 1987 beim schwedischen Autozulieferer Autoliv an, wo er die Leitung der Entwicklungsabteilung Deutschland übernahm. Autoliv ist heute einer der größten Systemanbieter für Insassenschutzsysteme und einer der großen Wettbewerber von ZF Friedrichshafen. Hauptgeschäft waren damals vor allem Gurtsysteme. Doch nur ein Jahr nach Dienstbeginn sollte er den Bereich Gurtsysteme wieder abgeben, dafür eine Airbag-Sparte aufbauen. Nur wie? „Ich war mir sicher, dass das nur mit eigener Crash-Anlage geht“, erinnert sich der 72-Jährige an seine Bedingung. Nur so könne man als Neueinsteiger Kundenvertrauen gewinnen. Letztlich überzeugte sein Vorschlag auch Chefs und Investoren. Die Anlage wurde in Dachau gebaut. Später folgten weitere Einrichtungen in anderen Ländern. Ein fertiges Produkt konnten Schaper und sein kleines Team damals allerdings noch nicht vorweisen. Lediglich das Ziel, Airbags zum Standard zu machen, war vorhanden.
Der Weg dahin schien jedoch unmöglich. „Wir nahmen uns vor, den Preis für Airbags auf ein Drittel zu reduzieren.“ Bisherige Modelle setzten auf große Luftsäcke, die über eine chemische Reaktion mit Stickstoff gefüllt wurden. Neben dem hohen Preis waren auch die Bauteile zu groß, um sie optisch ansprechend in Lenkräder zu verbauen. Schapers Ansatz war daher, zusammen mit internationalen Kollegen, kleinere Säcke mit Hilfe von kleinen Mengen Sprengstoff zu füllen. Der Gasgenerator sollte nicht größer als eine alte Filmdose sein. Gesagt, getan. „Wir haben uns zwei Opel Omega 3000 als Versuchsobjekte gekauft.“ Einen Prototyp präsentierte er 1990 bei BMW, verbaut in einem schicken Sportlenkrad eines 850er Coupés. Bis dato hätte ein Airbag niemals dort hineingepasst. Die BMW-Verantwortlichen konnten kaum glauben, was Schaper in Aussicht stellte und erteilten sofort den Auftrag für ein Nachrüstmodell. Die Airbag-Sparte von Autoliv begann zu wachsen.

- Airbags in Serie: Richtig Fahrt nahm das Wachstum allerdings erst durch weitere Kooperationen auf. Bei Ford ging mit dem Mondeo im Jahr 1992 erstmals in Deutschland ein Airbag in Serie. Schapers Team bot auch Beifahrer-Airbags an, die bei BMW, Renault und Peugeot verbaut wurden. Was noch fehlte, war ein Insassenschutz für seitliche Kollisionen. Zwei Jahre entwickelte Schapers Team daher in einem Geheimprojekt unter dem Decknamen „Weißwurst„ einen Kopfseitenairbag. Der Name rührte von der Ähnlichkeit der Wurst mit einem Stück Feuerwehrschlauch her. Die Idee dahinter war, dass schlauchartiges Gewebe sich beim Aufblasen verkürzt, was ermöglichte, in wenigen Millisekunden ein Luftpolster im seitlichen Kopfbereich im Fensterbereich erscheinen zu lassen, später auch eine Art Vorhang. „Es war toll, wie sich alle Beteiligten reingehängt haben“, schwärmt Schaper von dieser Zeit. Die Neuentwicklung ging schließlich 1994 im neuen 7er BMW erstmals in Serie, später im Audi A4 und in weiteren Modellen.
- Mobile Zukunft: „Ich bin viel unterwegs und fahre gerne schnell“, erzählt Schaper. Sein Auto hat daher einen Dieselmotor, der sportlich und sparsam zugleich ist. Verbrennermotoren wird es seiner Meinung nach auch weiterhin geben. Elektromobilität sieht er in den kommenden 20 Jahren eher im Stadtverkehr sowie bei Kurzstrecken. Wegen schneller Tankvorgänge und sauberer Verbrennung würde er gerne auf ein Wasserstoff-Auto umsteigen. Allerdings sei das Tankstellennetz noch zu lückenhaft, die Technik zu teuer. „Das Thema Sicherheit ist heute händelbar“, da ist sich der Ingenieur sicher. Aktuell sieht er mögliche Einsatzgebiete für Wasserstoff eher im Lastverkehr, in Flugzeugen oder Schiffen. Auf dem Weg in die mobile Zukunft sei es wichtig, neue Ansätze zu entwickeln und Bestehendes auch mal infrage zu stellen. „Warum in den Innenstädten nicht Laufbänder installieren?“, regt er beispielhaft an.