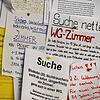Herr Breyer, was läuft falsch bei der Wohnungspolitik?
Zunächst mal die Diagnose, dass wir angeblich eine Mietenexplosion gehabt haben. Das wurde in der Politik und auch in den Medien behauptet. Das ist falsch. Denn wenn man sich anschaut, wie der Verbraucherpreisindex in den letzten 20 Jahren gestiegen ist und wie der Teilindex Mieten gestiegen ist, dann sind diese völlig parallel. Der Mietenindex ist sogar ein kleines bisschen weniger gestiegen.
Woher kommt dann der Eindruck einer Explosion der Mietpreise?
Die Mieten haben seit etwa 2008 aufgeholt, insbesondere in beliebten Großstädten wie Berlin und München und natürlich auch in Universitätsstädten wie Konstanz. Und deswegen ging man bei diesen Bemühungen, in den Wohnungsmarkt einzugreifen, immer von falschen Voraussetzungen aus, nämlich von der Voraussetzung, dass es eine Mietenexplosion gegeben habe, die aber nicht stattgefunden hat.
Wie würden Sie dann das nennen, was auf dem Wohnmarkt passiert?
Ein stärkeres Auseinanderklaffen der Bestandsmieten und Neuvermietungsmieten, und zwar insbesondere in Städten mit großem Zuzug. Wenn plötzlich viele Menschen in eine Stadt ziehen, steigt die Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt. Und dadurch waren die Neumieten natürlich höher als die bisherigen. Und das hat man dann mit der Mietpreisbremse oder mit dem verfassungswidrigen Mietendeckel versucht zu stoppen.
… aber bislang wenig erfolgreich.
Das ist auch der falsche Ansatz. Denn da, wo es zu einem Auseinanderklaffen von Angebot und Nachfrage kommt, muss man das Angebot stärken. Und das Angebot kann man langfristig durch mehr Bauen stärken. Kurzfristig muss man den Preismechanismus wirken lassen.
Und wie kann das eine Lösung sein?
Wenn es sich für die Vermieter lohnt, dann stehen etwa Einliegerwohnungen nicht mehr leer und werden auch nicht nur als Ferienwohnungen vermietet, sondern als dauerhafter Wohnraum. Und auf der Nachfrageseite versuchen Mieter mit weniger Quadratmetern auszukommen. Ich nehme mal als Beispiel eine WG, die eine Vierzimmerwohnung in Aussicht hat. Für die wäre es natürlich schön, wenn sie ein Wohnzimmer hat. Also ziehen drei Leute ein und haben ein Wohnzimmer. Wenn die Wohnung aber zu teuer wird, kann man sich das nicht mehr leisten. Und dann?
Dann nimmt die Wohngemeinschaft noch mal einen Mieter dazu.
Dann wohnen vier Leute in derselben Wohnung. Also sowohl von der Angebotsseite als auch von der Nachfrageseite hilft der Preismechanismus. Und die beklagte Wohnungsnot ist die Folge des Eingriffs in diesen Mechanismus.
Steigen als Folge dann nicht einfach die Wohnungsmieten?
Wenn bei Wohnungsbesichtigungen auf einmal 50 Leute erscheinen und das Treppenhaus voll mit Interessenten ist, dann ist das das beste Zeichen dafür, dass wir eben gerade keine zu hohen Mieten, sondern zu niedrigen Mieten haben. Und wer die Wohnung bekommt, fühlt sich wie ein Lottogewinner, aber alle anderen sind enttäuscht. Woran liegt das? Offensichtlich nicht daran, dass die Miete zu hoch ist. Wir haben einfach eine Übernachfrage.
Oder es gibt einfach zu wenig Mietwohnungen…
… weil es sich unter einem Mietendeckel für Eigentümer nicht lohnt, Wohnungen zu vermieten. Stattdessen verkaufen sie sie als Eigentumswohnungen, was etwa in Berlin tatsächlich in großem Umfang geschehen ist.
Kann der soziale Wohnungsbau da helfen?
Der soziale Wohnungsbau ist zwar eine schöne Idee, aber er löst das Problem nicht. Man kann mit dem sozialen Wohnungsbau niemals dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum hinterherbauen. Das wird man nie schaffen, zumal für wirklich Bedürftige auch die Kostenmiete schon zu hoch sein kann.
Wozu raten Sie stattdessen?
Man muss zusätzliche Instrumente auf der Nachfrageseite haben. Wir unterscheiden in der Ökonomie immer zwischen Objektförderung und Subjektförderung. Und man sollte Subjekte fördern, also Menschen unterstützen, und nicht das Erstellen von Objekten. Viel zielgerichteter ist Wohngeld. Da geht es tatsächlich um die aktuelle Bedürftigkeit und nicht über die frühere Bedürftigkeit. Das kann man zielgenau einsetzen und man kann jährlich die Einkommensverhältnisse abfragen.
Steht eine Stadt in der Pflicht, allen Gesellschaftsschichten das Wohnen zu ermöglichen?
Vor einigen Tagen habe ich im SÜDKURIER einen Artikel gelesen über eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, die nicht aus Deutschland kommt und am Konstanzer Wohnungsmarkt wohl diskriminiert wird. Für solche Fälle sollte eine Kommune wie Konstanz einstehen und ihnen bei der Vergabe von städtischen Wohnungen speziell Vorrang einräumen. Das wäre gute angewandte Sozialpolitik.