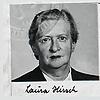Mattis Neumann will sich dafür einsetzen, dass nicht mehr geschieht, was vor 92 Jahren begann und Millionen Menschen das Leben kostete. Der 28-Jährige macht sich stark für die Demokratie und gegen das Vergessen des Grauens in der Zeit des Nationalsozialismus (1933 bis 1945). Seine Großeltern haben ihm die Patenschaft für den Stolperstein von Anton Wahl in der Hindenburgstraße 18 geschenkt, wo er selbst wohnt.
Seine Familie, so sagt er bei der Verlegung, habe sich stark mit der Vergangenheit und der Rolle der Urgroßeltern auseinandergesetzt. „Es gab immer so Hinweise“. Inzwischen sei klar, dass sie am Unrechtsregime mitwirkten. Die aktuelle Verlegung der Stolpersteine zeigt, wie im Dritten Reich alle ausgeschaltet wurden, die nicht ins Regime passten.
Der Künstler Gunter Demnig lässt die Gedenktafeln aus Messing ins Pflaster ein. Auf ihnen sind die Namen und die Schicksale von Opfern des Nationalsozialismus vermerkt, so etwa die des Gipsers und Gewerkschafters Anton Wahl in der Hindenburgstraße. Im Ersten Weltkrieg war Wahl Soldat. 1918 wurde ihm das Kriegsverdienstkreuz verliehen.
Anton Wahl: Schikaniert und verhaftet, weil er Gewerkschafter war
In den 1920er-Jahren wurde er bei den Konstanzer Gemeinderatswahlen zweimal für die KPD in den Bürgerausschuss gewählt und 1928 auch zum Geschäftsführer der Gewerkschaft der Bauarbeiter. Der Kommunist und Gewerkschafter wurde schon am 2. Mai 1933 verhaftet und nach seiner Entlassung permanent von der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) überwacht und durch Hausdurchsuchungen schikaniert.
Am 22. August 1944 wurde Anton Wahl erneut verhaftet und ins Konzentrationslager Natzweiler-Struthof (Elsass) gebracht. Dort musste er Frondienste leisten und wurde Anfang September 1944 nach Dachau verlegt, dann aber entlassen. Nach dem Krieg wirkte er am Aufbau der Gewerkschaften in Konstanz mit. 1952 starb er. Der 89 Jahre alte Amandus Erne sagt, er habe Anton Wahl und seine Frau noch kennengelernt. Er wohnte als kleiner Junge in der nahen Markgrafenstraße. In die Innenhöfe des Hindenburgblocks kam er zum Kicken. „Da haben meine Spielkollegen gewohnt.“
Bertha Cohn: Deportiert nach Auschwitz, weil sie Jüdin war
Die 84 Jahre alte Heidi Keller hat die Zeit des Nationalsozialismus ebenfalls ein kleines Kind erlebt. Sie kommt zur Verlegung des Stolpersteins für die Jüdin Berta Cohn in der Bruderturmgasse 6. Heidi Keller sagt, sie habe schräg gegenüber bei den Großeltern gewohnt. In diesem Haus ist heute das Modegeschäft N27 untergebracht. Zur Mädchenzeit von Heidi Keller war es eine Rettungswache des Roten Kreuzes.
Im kindlichen Unterbewusstsein habe sie mitbekommen, dass es die Nazi-Diktatur gab. Sie erinnert sich, wie sie damals den Platz sah, an dem die Konstanz Synagoge gesprengt und niedergebrannt wurde. Am Zaun habe sie immer wieder kleine Geschenke abgelegt, für die Kinder, die in ihrer Fantasie auf dem Platz lebten. Immer, wenn ein Geschenk weg war, habe sie gedacht, sie hätten es sich genommen. In der Bruderturmgasse erfährt sie, wie Berta Cohn deportiert wurde, nur weil sie Jüdin war.
Die unverheiratete Masseurin durfte nach der Machtübernahme der Nazis ihren Beruf nicht mehr ausüben. Der Historiker Uwe Brügmann legt dar, wie Juden damals aus dem öffentlichen Leben verdrängt wurden. Sie durften zum Beispiel nur zu bestimmten Zeiten einkaufen und keine Cafés besuchen. Am 20. Oktober 1940 wurde Berta Cohn mit 112 Juden von Konstanz nach Gurs deportiert, einem Lager, in dem die Lebensbedingungen katastrophal waren. Die Häftlinge mussten zum Teil auf nacktem Lehmboden und ohne Fenster schlafen.
Rund 400 Menschen überlebten die Torturen nicht. Sie starben an Hunger und Krankheiten. Auch Berta Cohn erkrankte schwer, überlebte aber noch. Der genaue Todeszeitpunkt ist nicht bekannt. Wahrscheinlich starb sie am 10. August 1942, als sie nach Auschwitz transportiert werden sollte. In den 50er-Jahren wurde sie für tot erklärt. Brügmann sagt, die Recherchen gestalteten sich unterschiedlich. Bei einer Person gebe es viel Material, bei einer anderen, wie Berta Cohn, sehr wenig.
Anna Madlinger: Verhaftet, weil sie mit Mädchen Obst sammelte
An Anna Madlinger ist zu sehen, wie Nazi-Organisationen versuchten, den Einfluss der Kirchen zu beschneiden. Sie war 1921 dem Orden der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz in Hegne beigetreten und nahm den Name Schwester Otmunda an. Als Kinderschwester war sie ab 1938 im katholischen Kinderheim Haus Nazareth in der Säntisstraße 4 im Einsatz. Dort sitzt heute der Sozialdienst katholischer Frauen mit Einrichtungen wie der Säntisschule.
Hier wurde der Stolperstein für Anna Madlinger verlegt, denn sie erlebte Dramatisches. Im Sommer 1942 schwärzte jemand die Ordensschwester an: Sie sammelte mit einer Gruppe Mädchen aus dem Haus Nazareth auf der Insel Reichenau Obst, anstatt sie in den Bund-Deutscher-Mädel-Unterricht (kurz: BDM) des Terrorregimes zu schicken. Man warf ihr „Misshandlung“ der ihr anvertrauten Kinder vor und verhaftete sie. Sie verbrachte Monate im Konstanzer Gefängnis, dann wurde sie zu einer Haftstrafe von zehn Monaten verurteilt.

Sie kam in die Frauenstrafanstalt Gotteszell, dann ins KZ Ravensbrück. Sie arbeitete im Krankenrevier, erkrankte selbst und erlitt einen Herzinfarkt. Sie erlebte die Befreiung des KZ, kam zurück ins Kloster Hegne, verließ dieses 1946. Sie arbeitete weiter karitativ, bis sie 1951 als arbeitsunfähig eingestuft wurde. Sie war fast mittellos, soll aber bis ins hohe Alter Kranke und Sterbende privat besucht haben.
Karl Lumpp: Ermordet, weil er geistig und körperlich beeinträchtigt war
Wie fürchterlich das Naziregime mit Behinderten umging, zeigt sich an Karl Lumpp. Ein Stolperstein für ihn liegt nun in der Hüetlinstraße 12. Karl Lumpp wurde am 1. September 1914 in Konstanz geboren, zeitweise wohnte er in der Hüetlinstraße. Als er fünf Jahre alt war, kam er ins katholisch geführte St. Josefshaus bei Lörrach, wo er fast elf Jahre lebte. Der Junge war geistig beeinträchtigt.
Es wurde ein Zwergwuchs diagnostiziert. Kurz vor seinem 16. Geburtstag wurde er in die Heil- und Pflegeanstalt bei Konstanz überstellt (heute ZfP Reichenau). Er verbrachte dort ein Jahrzehnt. Im Jahr 1940 wurde er Opfer des Massenmords an Behinderte (Aktion T4). Der fast 26-Jährige wurde nach Grafeneck verschleppt und dort vergast und eingeäschert.
Frieda Böhler: Ermordet und zwangssterilisiert wegen Behinderung
Frieda Böhler wurde als Behinderte zwangssterilisiert und ermordet. Ein Steindenkmal erinnert nun an sie in der Marienhausgasse 4. Sie wurde 1906 zu früh geboren. Im zweiten Lebensjahr bekam sie Fieberkrämpfe. Zurück blieben eine Sehschwäche. Immer wieder war sie in ärztlicher Behandlung.
Sie konnte keine Ausbildung machen. Sie blieb im Elternhaus und half im Haushalt. Ihr Zustand verschlechterte sich. Nach Aufenthalten in der Heil- und Pflegeanstalt bei Konstanz wurde sie dort ab dem 4. Februar 1930 dauerhaft untergebracht. Mit 34 Jahren wurde sie in Grafeneck ermordet.