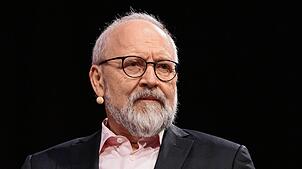Wasserstoff ist eines der Zauberwörter für die Energieversorgung der Zukunft. Denn dieses Gas kann man mithilfe von Ökostrom gewinnen, mit dem man Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff aufspalten kann. Wenn man den Wasserstoff verbrennt – also mit Sauerstoff reagieren lässt – entstehen wieder Hitze und als Abgas lediglich Wasserdampf. Theoretisch ist das also eine Lösung dafür, große Mengen an Energie für die Industrie klimaneutral bereitzustellen. Groß war in Singen daher die Kritik daran, dass die Region am westlichen Bodensee nicht ans geplante Wasserstoffkernnetz des Bundes angeschlossen werden soll.
Lokale Herstellung statt Anschluss ans Kernnetz
Stattdessen soll es lokale Lösungen für die Wasserstoffversorgung geben. Wie die aussehen könnten, steht in einem lokalen Wasserstoffkonzept, das die Stadt vom Steinbeis-Innovationszentrum (SIZ) Energieplus in Stuttgart, der Hochschule Technik, Wirtschaft, Gestaltung (HTWG) in Konstanz und dem Solarforschungszentrum ISC Konstanz erstellen ließ. Bene Müller, Vorstandsvorsitzender des Singener Bürgerunternehmens Solarcomplex, ist indes skeptisch, ob es gelingt, ein wirklich lokales Wasserstoffkonzept zu verwirklichen, bei dem auch der notwendige Strom aus der Region kommt.
Die Kosten für das Wasserstoffkonzept beziffert die Vorlage für die jüngste Sitzung des Gemeinderatsausschusses für Stadtplanung, Bauen und Umwelt (SBU) mit knapp 100.000 Euro, von denen allerdings 90 Prozent vom Land gefördert werden. Aus dem Stadtsäckel werden also nur knapp 10.000 Euro für das Konzept fällig.

Für ihr Szenario haben die Autoren des Konzepts den voraussichtlichen Bedarf an Wasserstoff bei fünf großen Singener Unternehmen betrachtet. Sie kamen zum Schluss, dass im Jahr 2040 etwa 10.700 Tonnen Wasserstoff pro Jahr in Singen gebraucht werden. Falls mehr Prozesse in der Industrie auf Strom umgestellt werden können, könnte man auch mit 8900 Tonnen pro Jahr auskommen.
An dieser Stelle meldet sich Bene Müller von Solarcomplex mit seiner Skepsis zu Wort. Um ein Kilogramm Wasserstoff herzustellen, benötige man nämlich etwa 50 Kilowattstunden Strom, schreibt er an die Redaktion. Und er rechnet weiter: Für 10.000 Tonnen Wasserstoff brauche man dann 500 Millionen Kilowattstunden Strom – etwa 25 Mal das, was der Windpark Verenafohren in einem Jahr erzeuge. Außerdem brauche man für die Herstellung von einem Kilogramm Wasserstoff etwa neun Liter hochreinen Wassers – also etwa 90 Millionen Liter Wasser.
Politische Forderungen vom Solarcomplex-Chef
Müller verknüpft damit auch eine politische Forderung: Bei einem lokalen Wasserstoffkonzept müsse auch der Strom für die Herstellung des Wasserstoffs lokal erzeugt werden. Es sei unrealistisch, dass die Menschen auf der Schwäbischen Alb oder im Schwarzwald massenweise Windräder und Solarparks akzeptieren, um Singen mit Ökostrom zu versorgen.
Daher fordert Müller die politische Zustimmung zum Windpark auf dem Schienerberg ein, der 50 Millionen Kilowattstunden erzeugen soll – nach Müllers Rechnung also ein Zehntel dessen, was laut dem Singener Wasserstoffkonzept für die Erzeugung von Wasserstoff im Jahr 2040 notwendig werden könnte.
Dabei haben die Autoren des Konzepts sich auch über den Stromverbrauch für die Wasserstofferzeugung Gedanken gemacht und kommen zu ähnlichen Werten wie Müller. Inklusive des weiteren Stromverbrauchs gehen sie davon aus, dass 2040 jährlich 1130 Millionen Kilowattstunden Strom in Singen gebraucht werden. Sie errechnen aber auch, dass bis dahin 980 Millionen Kilowattstunden an regenerativem Strom pro Jahr in Singen erzeugt werden können.
Gibt es genügend Ökostrom für die Herstellung von Wasserstoff?
Die Stromerzeugung war auch in der Ausschusssitzung ein Thema, das kritisch beleuchtet wurde. So hinterfragte Walafried Schrott (SPD), ob in Singen nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch genügend Ökostrom für die Erzeugung von Wasserstoff gewonnen werden könne.
Thomas Stark, Professor an der HTWG, sagte dazu, dass man in der Regel nur einen Bruchteil des theoretischen Potenzials auch umsetzen könne. Das bedeutet, dass in der Praxis nicht so viel Ökostrom erzeugt wird, wie theoretisch möglich wäre. Die Produktion von Strom für die Wasserstoff-Erzeugung sollte man daher am besten kreisweit betrachten. Allerdings fließe der Ökostrom ohnehin nicht direkt in die Wasserstoff-Erzeugung, sondern werde an anderer Stelle ins Netz eingespeist. Denn der Elektrolyseur laufe rund um die Uhr und nicht nur dann, wenn Ökostrom zur Verfügung steht.
Eberhard Röhm (Grüne) regte an, den Wasserstoff nicht nur per Lastwagen, sondern auch mit der Bahn zu transportieren. Franz Reichenbach vom ISC Konstanz erwiderte dazu, ihm sei nicht bekannt, dass das irgendwo gemacht werde. Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler sah das hingegen als relevante Frage: „Wenn es auf der Straße geht, wird es auch auf der Schiene gehen.“ Die Stadt hoffe nun auf Fördergelder für die Errichtung von lokaler Wasserstoffinfrastruktur, so Häusler. Wasserstoff habe großes Potenzial, aber auch hohe Kosten.
Dieser Artikel erschien erstmals am 14. Januar und wurde mit der Stellungnahme von Bene Müller, Vorstandsvorsitzender Solarcomplex, ergänzt.