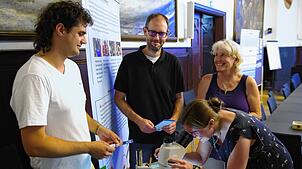Das Ende kommt schnell und mit etwa 360 Volt über eine Elektrozange, die am Kopf angesetzt wird. Die Betäubung setzt innerhalb von Sekundenbruchteilen ein, noch bevor der Schmerz das Gehirn erreicht hat. Wenn das Schwein weniger als eine halbe Minute später gestochen wird, bekommt es vom eigentlichen Schlachtvorgang nichts mit.
Auf den Schlachthöfen Färber und Holwegler in Villingen und Donaueschingen geschieht das an den Schlachttagen jeweils etwa hundert Mal. 25.800 Schweine werden in den beiden Betrieben jährlich geschlachtet, dazu kommen etwa 2600 Rinde und 1100 Schafe.
Kommen auf die beiden Schlachthöfe in Zukunft mehr Arbeit zu, weil der Balinger Schlachthof Ende des Jahres 2022 schließt? Im Ausschuss für Umwelt und Technik des Kreistags wurde das Thema vor Kurzem erörtert. Ab Sommer/Herbst 2022 sei ein starker Anstieg der Schlachtzahlen zu erwarten, so der Wortlaut der Sitzungsvorlage.
150 Schweine, 60 Rinder
Wie stellt sich die Situation aktuell dar? Teresa Schwarzmaier, seit Juli Leiterin des Veterinäramtes, sagt, dass durchaus denkbar sei, dass Tiere aus dem Raum Balingen künftig im Schwarzwald-Baar-Kreis geschlachtet werden. Aber: „Wohin die Schlachtungen dann im Einzelnen verlagert werden, lässt sich schwer vorhersehen, das ist ja freie Wirtschaft“, sagt sie. „Wir gehen von etwa 150 zusätzlichen Schweinen und 60 zusätzlichen Rindern pro Woche aus.“ Das könne aber nach oben oder unten abweichen.

Im Moment sind die Schlachtbetriebe überschaubar. „Von einem Großbetrieb sind wir mit unseren Zahlen ganz, ganz weit entfernt“, sagt die Tierärztin. Im Gegenteil: An den Schlachtbändern des Kreises gehe es sehr ruhig zu, längst nicht an jedem Haken hänge ein Tier, das begutachtet werden muss. Die ruhige Atmosphäre komme auch den Tieren zugute. Zum Vergleich: Beim Großschlachter Tönnies werden allein am nordrhein-westfälischen Standort Rheda-Wiedenbrück jeden Tag etwa 20.000 Schweine getötet.
Das Aus für den Balinger Schlachthof kommt nicht überraschend. Der Balinger Gemeinderat hatte bereits im Jahr 2017 beschlossen, den Pachtvertrag mit der Firma Färber nicht zu verlängern. Das umliegende Grundstück wird an zwei benachbarte Firmen verkauft, die dort expandieren möchten. Der Protest von Metzgern und Landwirten gegen das Auslaufen des Pachtvertrages blieb erfolglos.

Im kommenden Jahr wird sich zeigen, wohin die Balinger mit ihrem Schlachtvieh ausweichen. Das Veterinäramt im Schwarzwald-Baar-Kreis steht indes vor einer anderen Herausforderung: Es fehlt perspektivisch an Personal. Die beiden Tierärzte an den Schlachthöfen sind 57 und 74 Jahre alt – und für die Tätigkeit finde sich kaum neues Personal.
Besonders die Nachtarbeit ab 1 Uhr morgens mache die Arbeit in der Fleischhygiene wenig attraktiv. Am Villinger Schlachthof ist ein Amtstierarzt des Veterinäramtes tätig, in Donaueschingen ein amtlicher Tierarzt, das heißt: ein niedergelassener Großtierarzt, der im Auftrag der Behörde nebenberuflich im Bereich der Fleischhygiene tätig ist.
Jeder Körper wird untersucht
Die tierärztliche Arbeit im Schlachthof teilt sich in zwei Bereiche: in die Untersuchung der lebenden Tiere und die anschließende Fleischuntersuchung. Damit ist der Amtstierarzt beziehungsweise der amtliche Tierarzt nicht permanent im Stall oder an der Betäubungsanlage, sondern muss auch Aufgaben in der Fleischuntersuchung wahrnehmen.
Schlachtband muss angehalten werden
Zwar werden die Veterinäre von Fachassistenten unterstützt – in Donaueschingen gibt es aber keine. Daher muss der Tierarzt für Kontrollen das Schlachtband anhalten und seinen Platz bei der Fleischuntersuchung verlassen.
Gerade die Fleischuntersuchung sei zeitintensiv, sagt Teresa Schwarzmaier. Jeder einzelne Tierkörper werde untersucht, jede Leber, jede Lunge angeschaut. Unverzichtbar ist auch die Untersuchung auf Trichinen – Fadenwürmer, die für den Menschen gefährlich und potenziell tödlich sind. „Bei der Fleischuntersuchung ist man relativ fix an einen Platz gebunden und kann nicht mal eben in den Stall gehen“, sagt die Amtsleiterin. Um das zu gewährleisten, bräuchte man dauerhaft einen zweiten Tierarzt – was aber gesetzlich nicht vorgeschrieben sei.
26 Betriebe werden montags besucht
Selbst wenn die Tierärzte zu zweit wären – die Arbeit am Schlachthof ist nicht sonderlich gefragt. Ein amtlicher Tierarzt erhält beim Schlachthofdienst nach Bundes-Angestelltentarifvertrag 41,87 Euro pro Stunde. In einer Praxis seien hingegen pro Stunde etwa 100 Euro zu verdienen. „Früher war die Fleischbeschau finanziell interessanter“, sagt Teresa Schwarzmaier. „Heute überlegen es sich junge Kollegen zwei mal, ob sie eine solche Verpflichtung annehmen.“ Hinzu komme, dass junge Tierärzte sich praktisch keine Sorgen um ihre berufliche Zukunft machen müssten. „Momentan findet jeder einen guten Job.“
6,11 Euro für eine Begutachtung
Die amtlichen Tierärzte fahren zudem immer montags insgesamt 26 Metzgereien, Direktvermarkter und Gemeindeschlachthäuser im Kreis ab und nehmen dort die Fleischuntersuchungen vor. Sie werden nach Stückzahl vergütet. Für die Begutachtung eines Schweins gibt es beispielsweise 6,11 Euro.
Problematisch sei auch, dass viele niedergelassene Großtierpraktiker nahe am Rentenalter seien und nicht klar sei, ob künftige Nachfolger Interesse an amtlich-tierärztlichen Aufgaben haben. Die neun Amtstierärzte des Veterinäramtes, die sich auf acht Stellen verteilen, hätten für ständigen Einsatz auf den Schlachthöfen wiederum keine Kapazität.
„Etwa 50 Prozent unserer Arbeit ist Lebensmittelüberwachung, 50 Prozent Veterinärwesen“, erklärt Teresa Schwarzmaier. Zu letzterem gehört auch der Tierschutz wie das Anzeigen von Tierquälerei. Auch mit Tier-Messies haben es die Amtstierärzte immer wieder zu tun. Aber auch mit angeketteten Hunden oder in zu kleinen Käfigen gehaltenen Ziervögeln: „Wir gehen jeder Anzeige nach.“